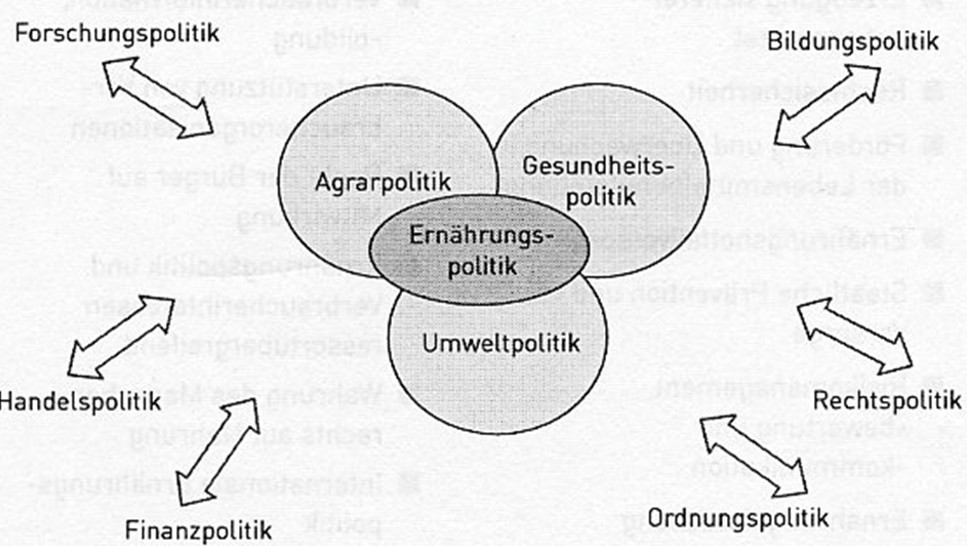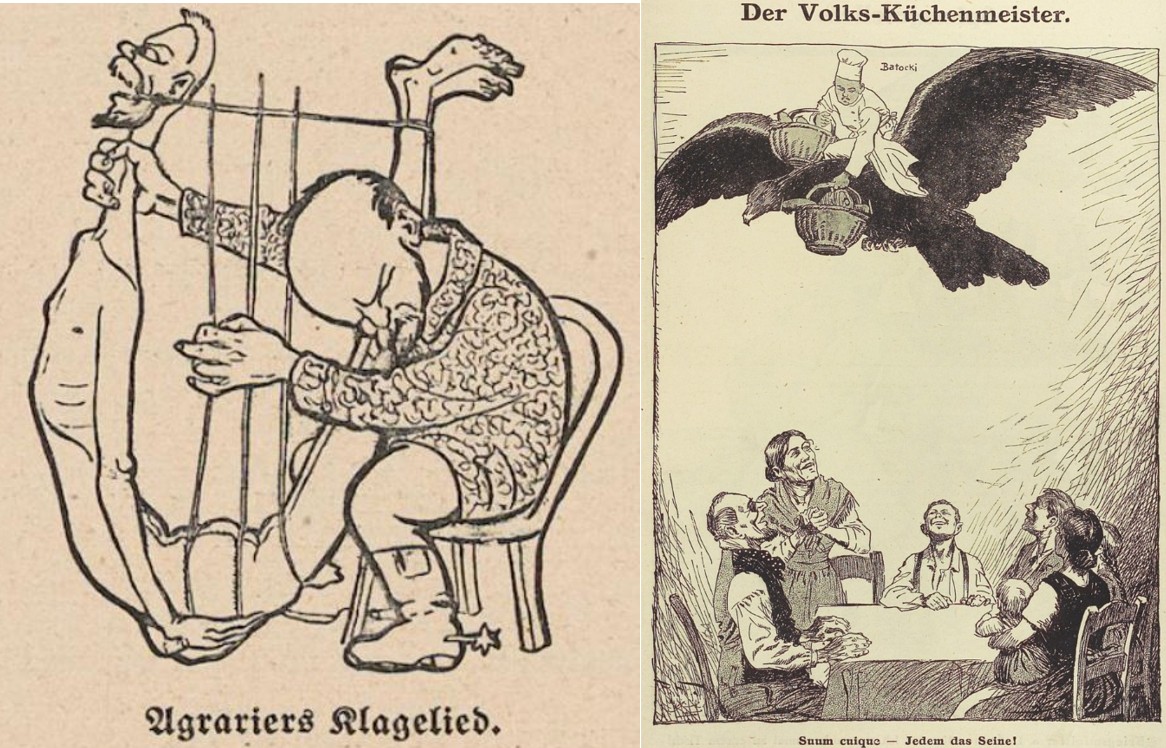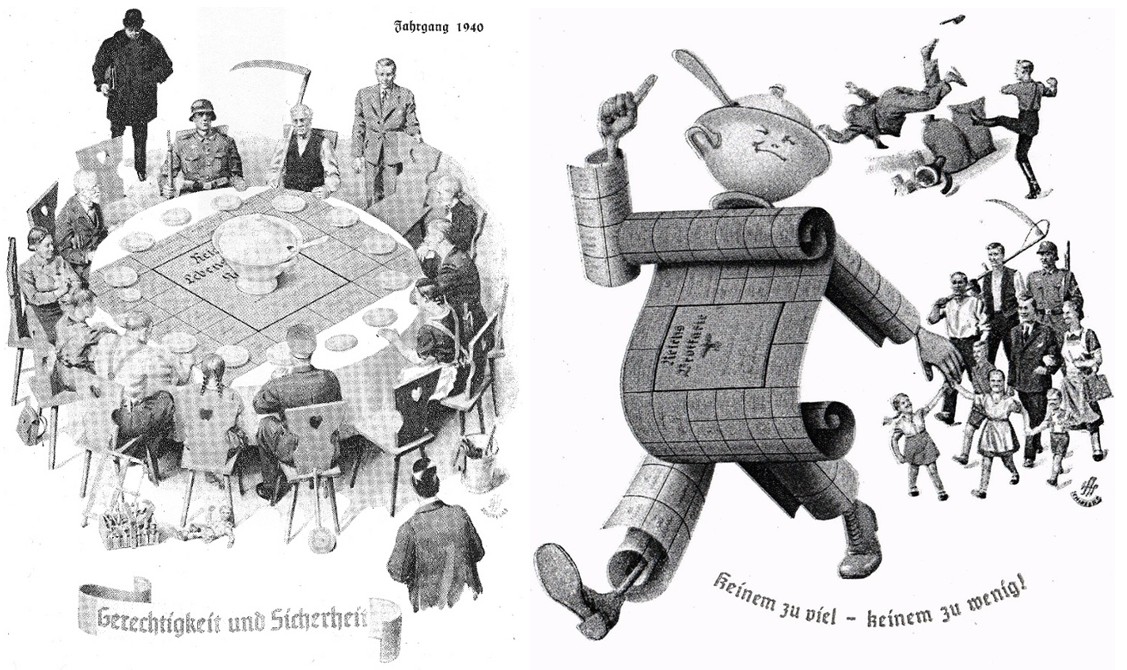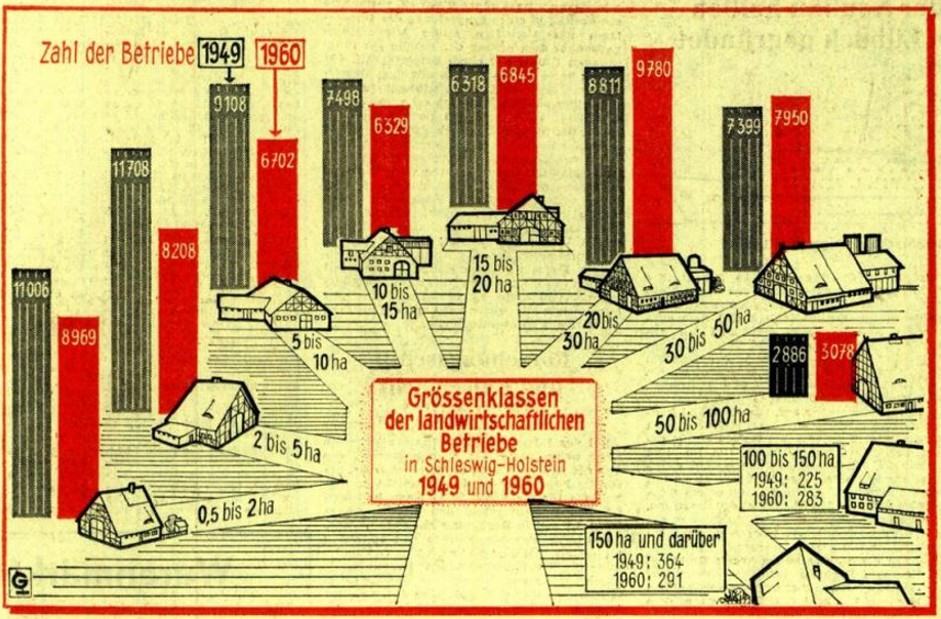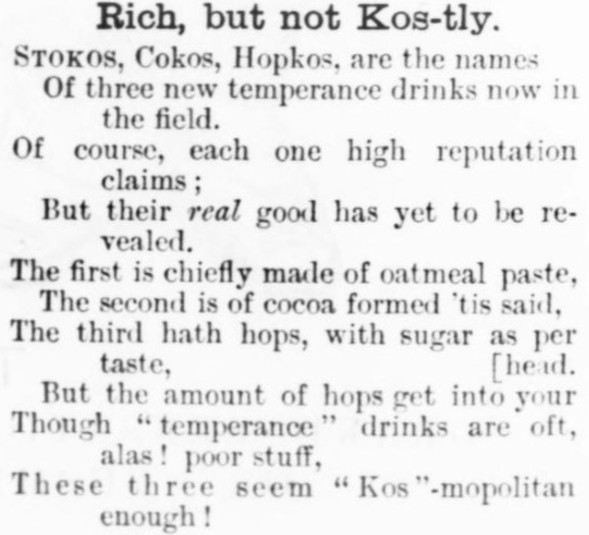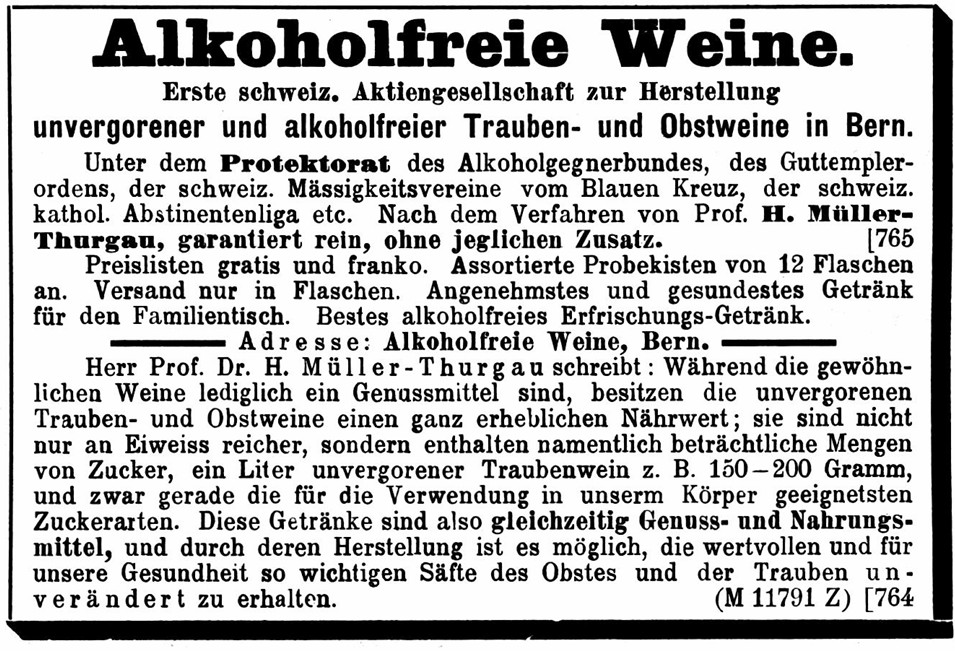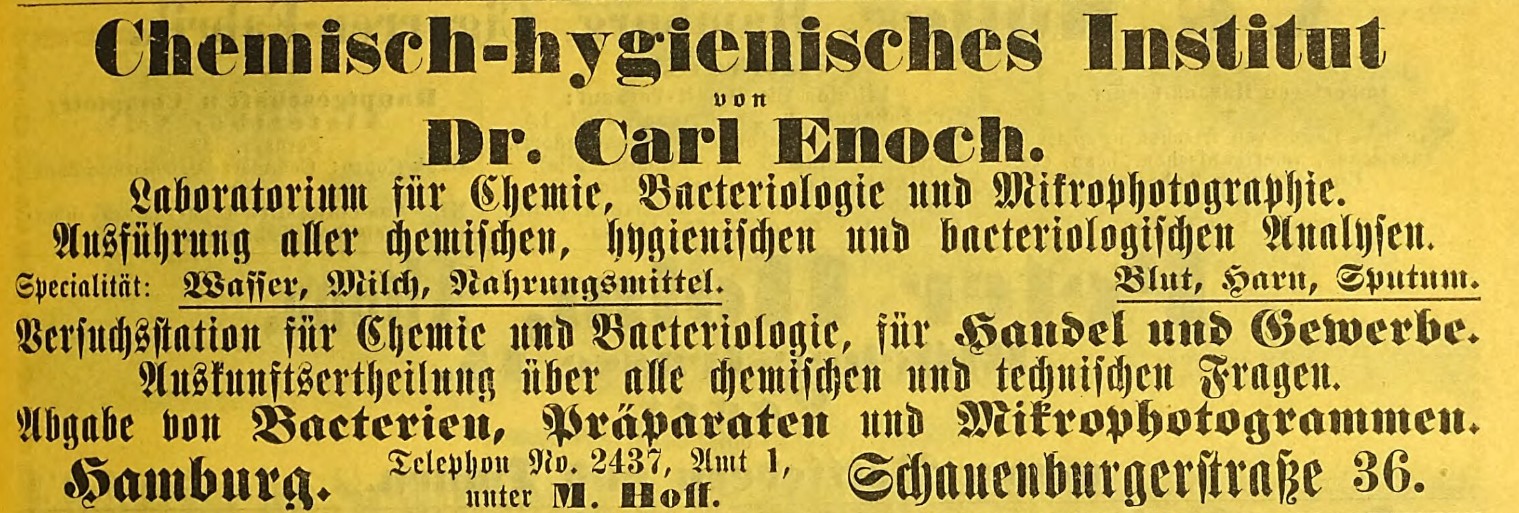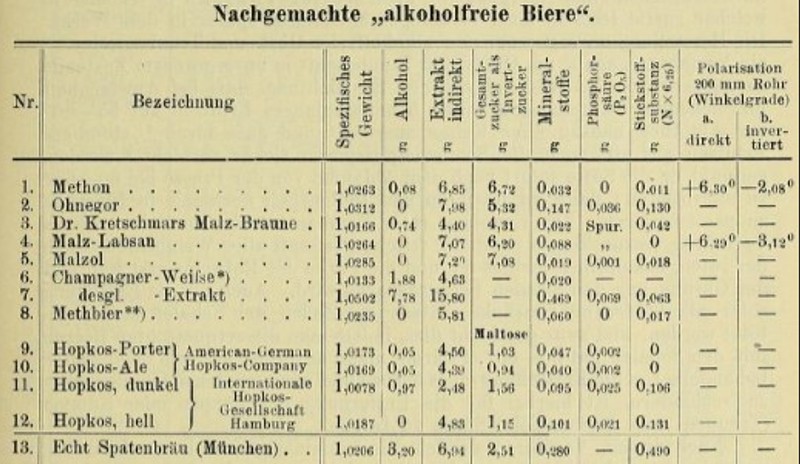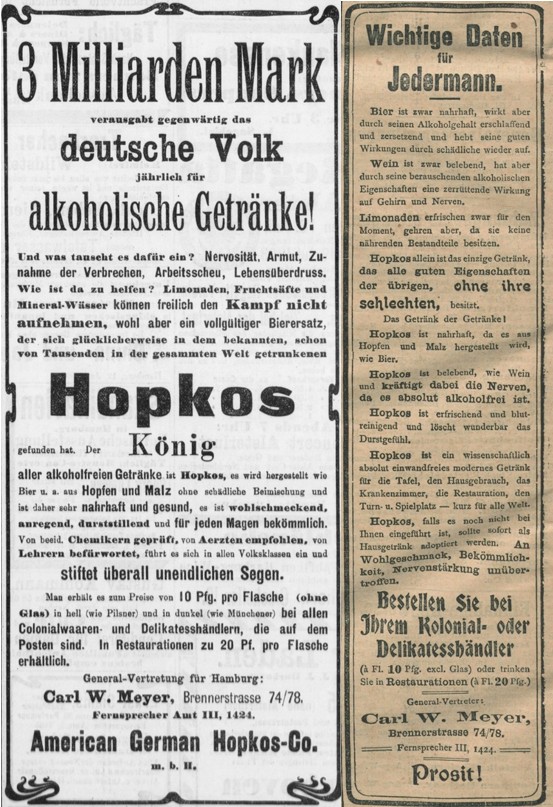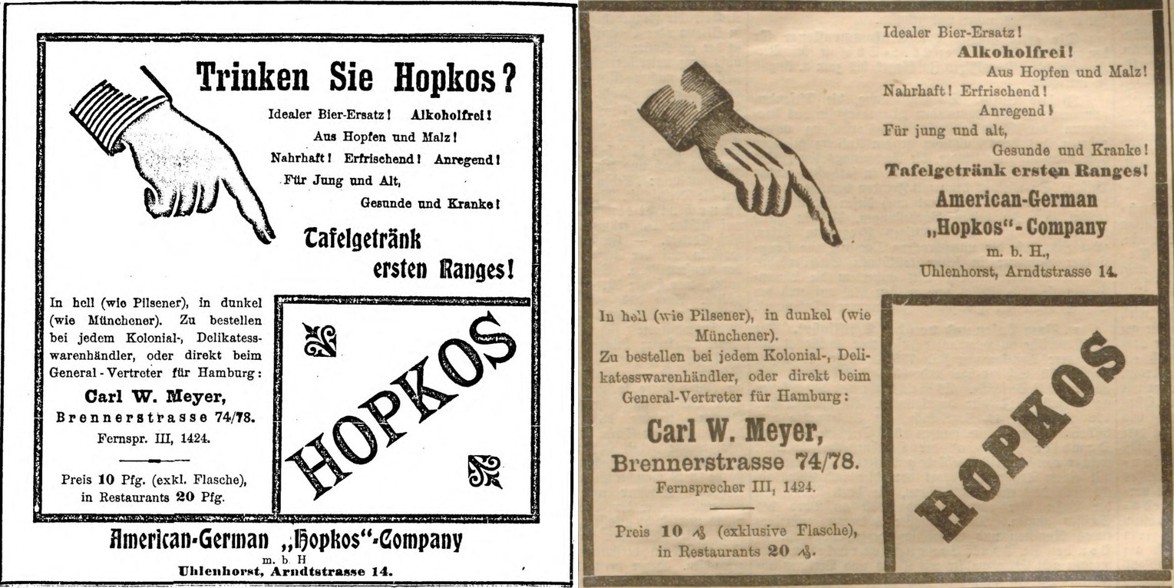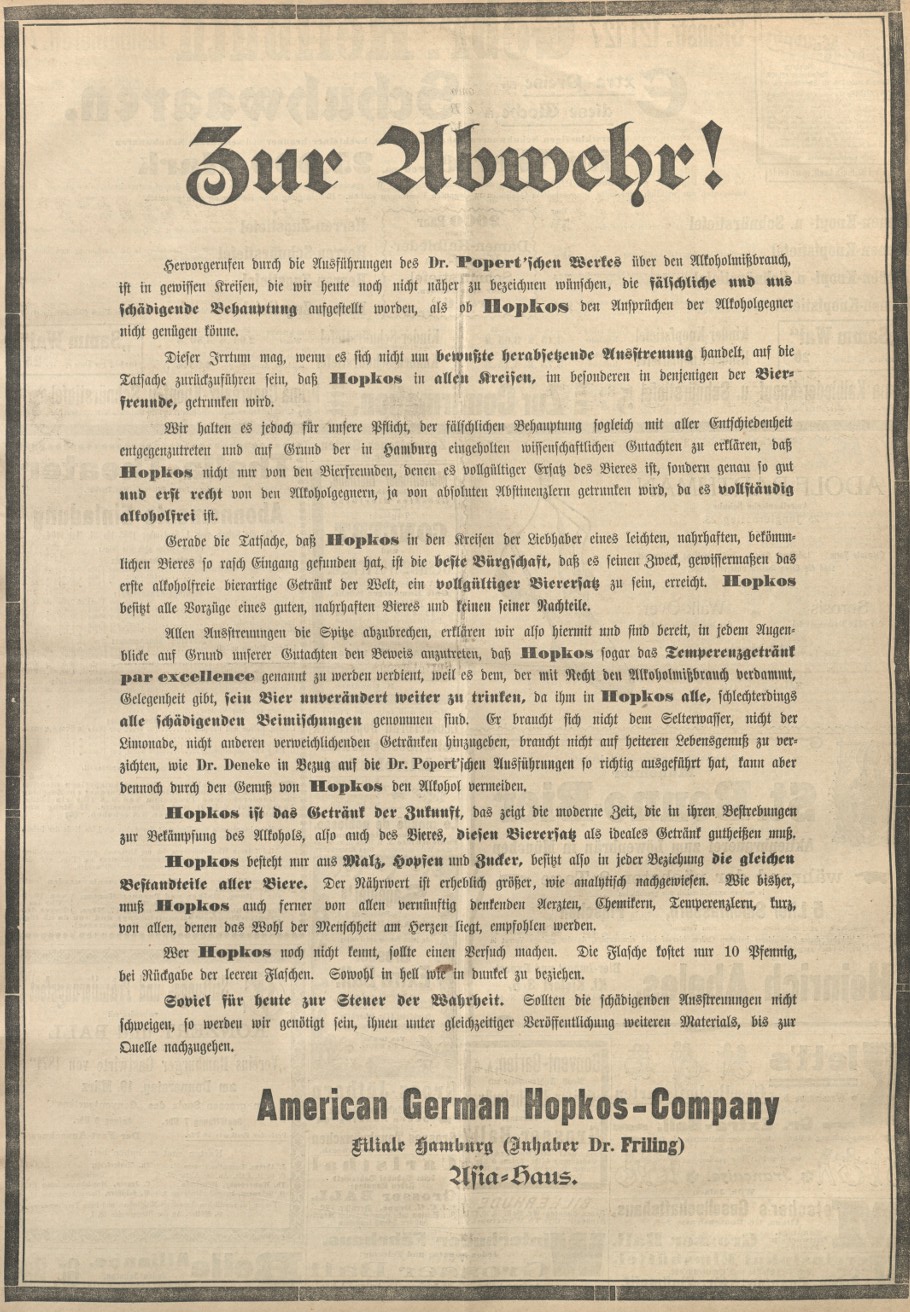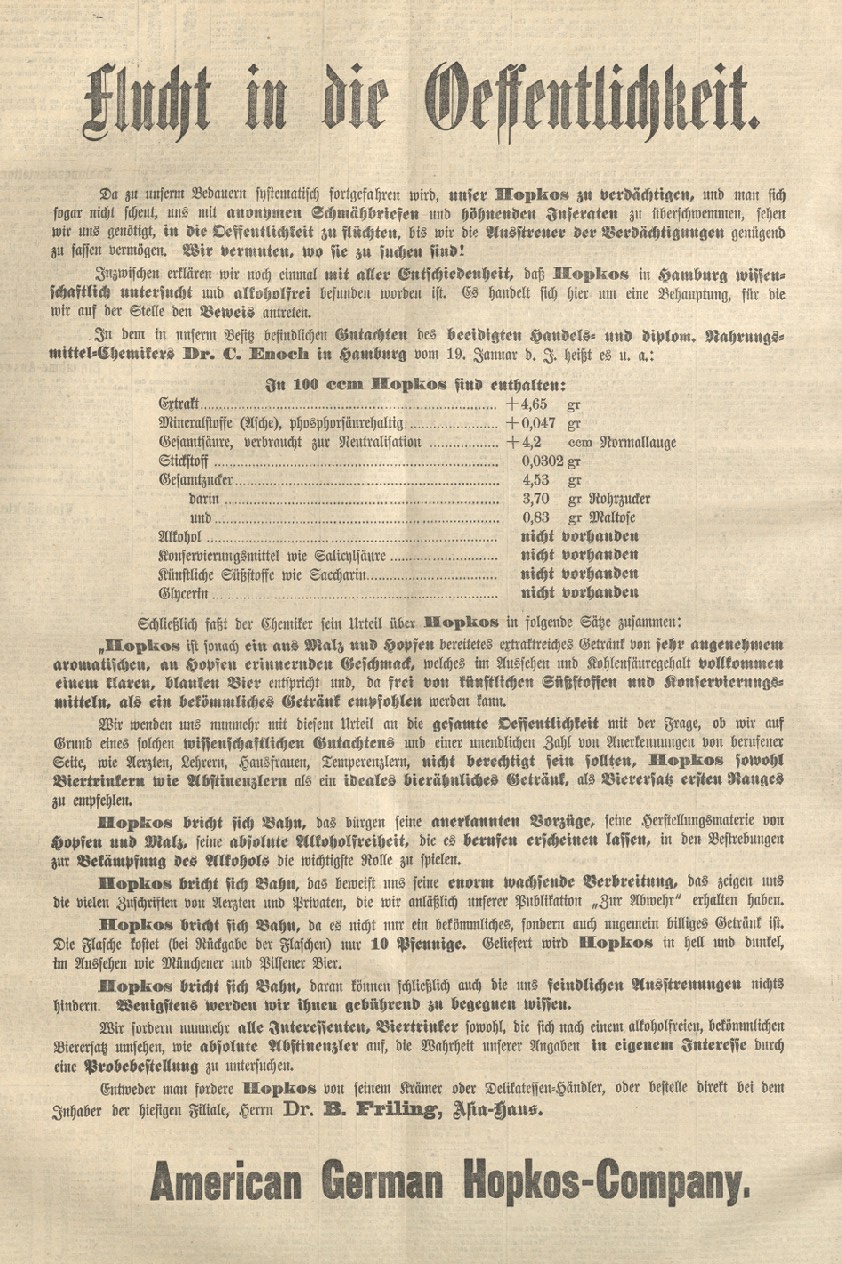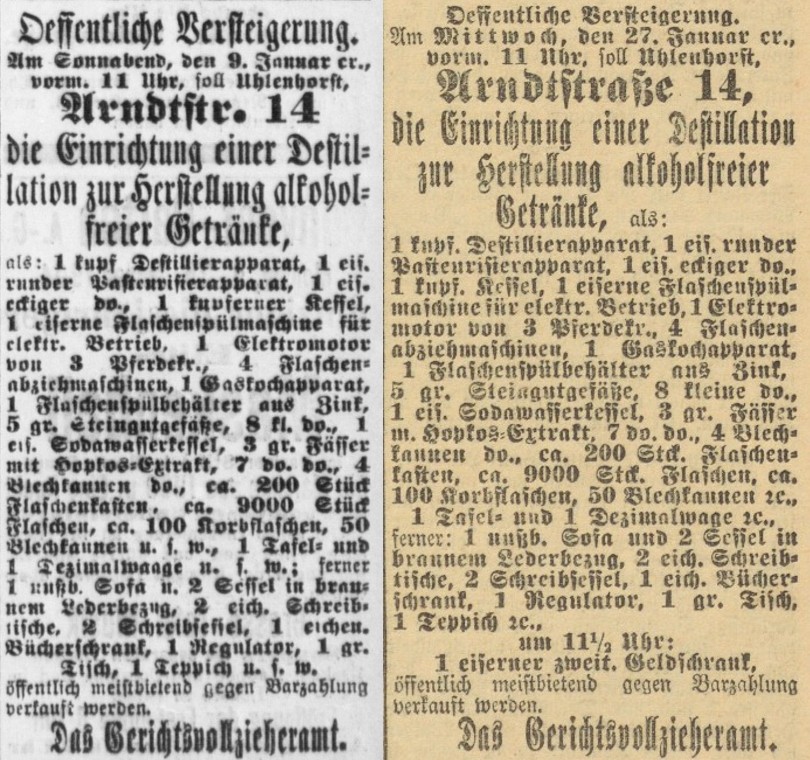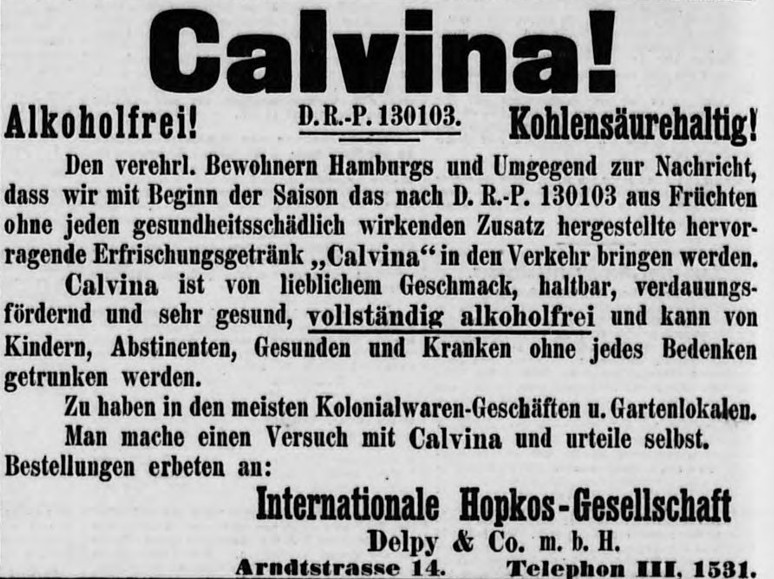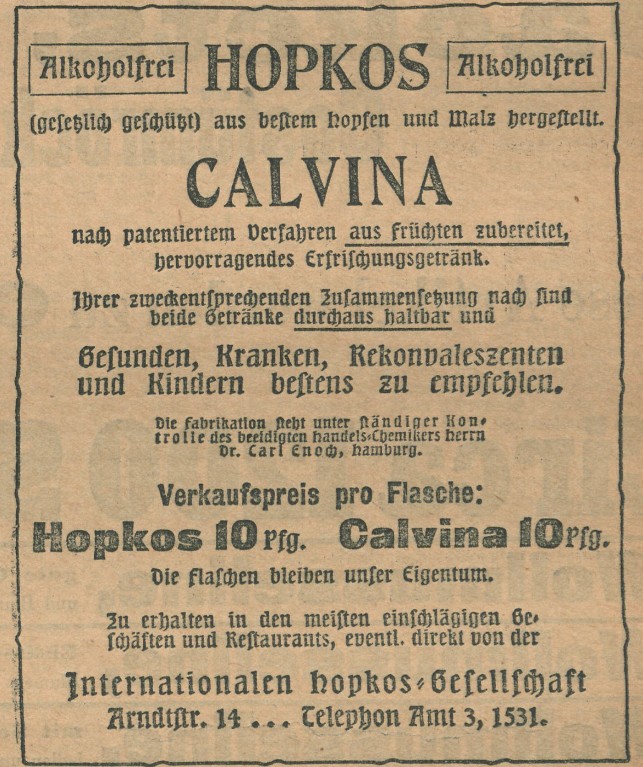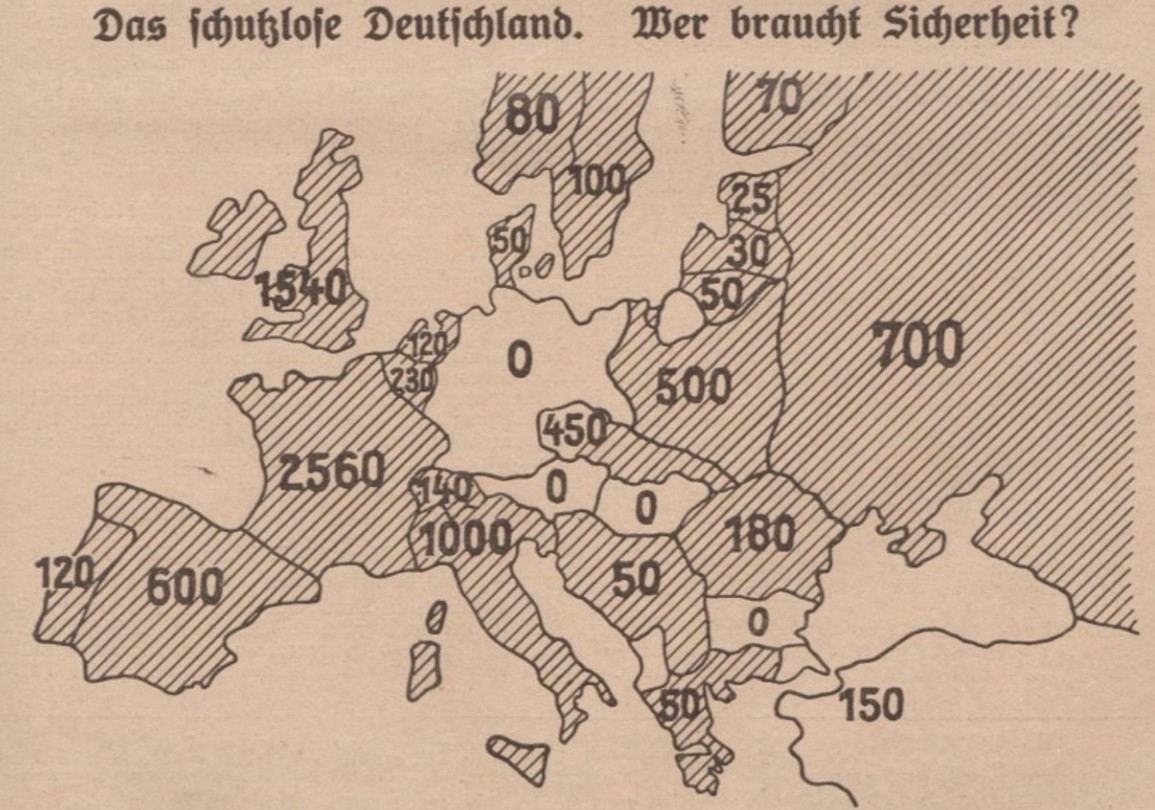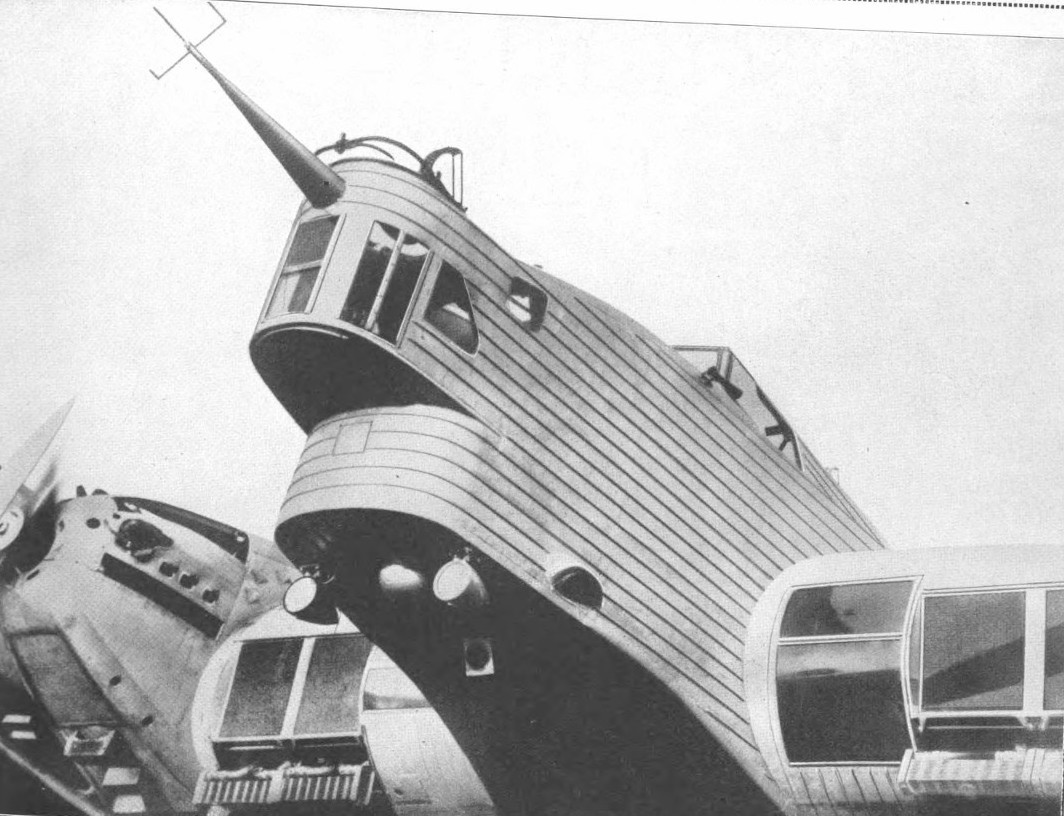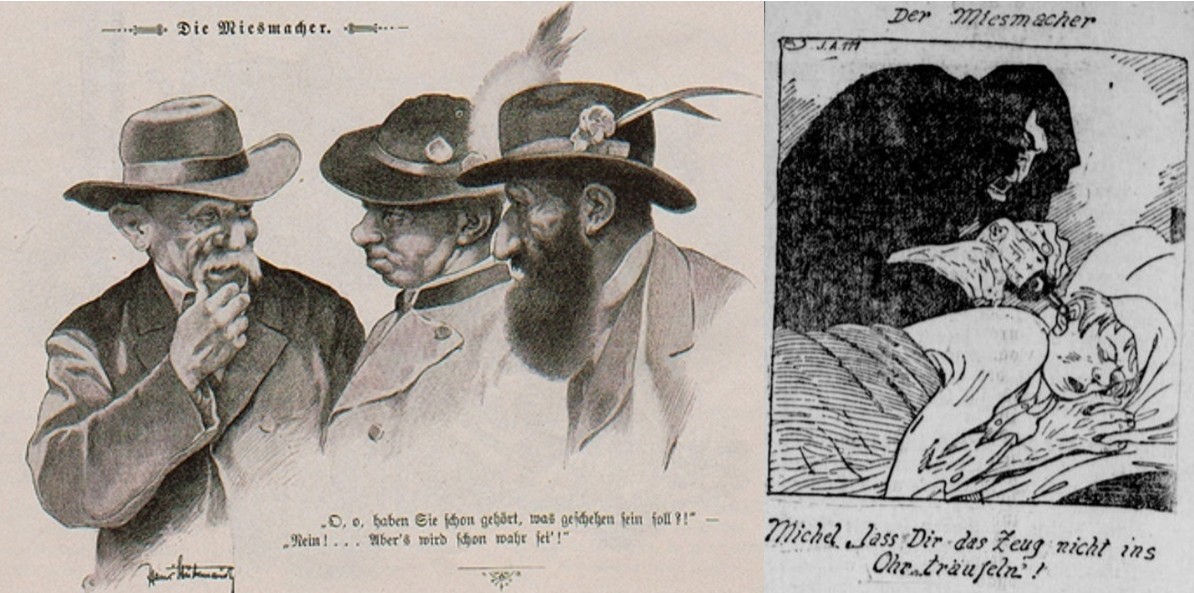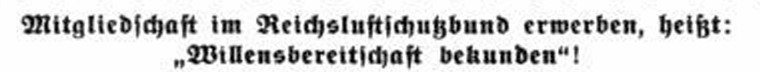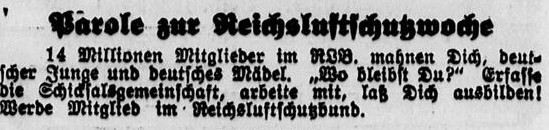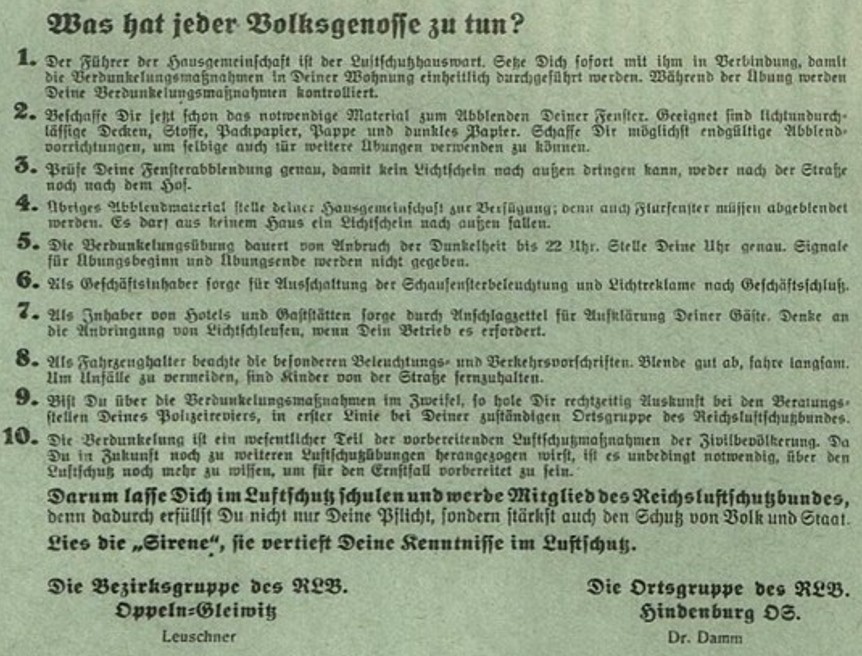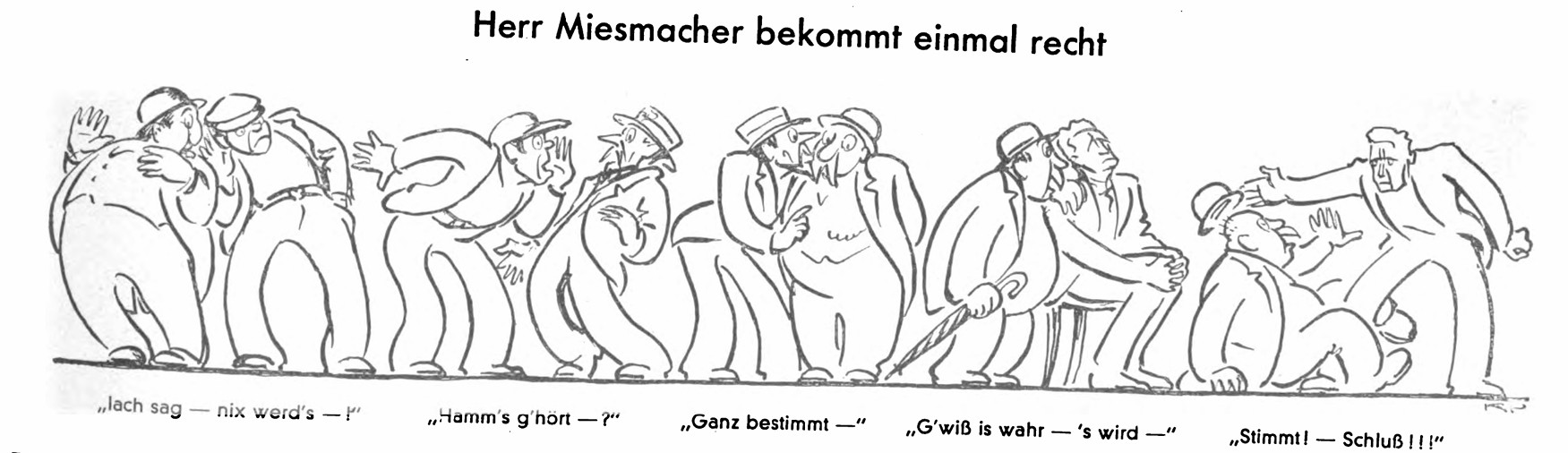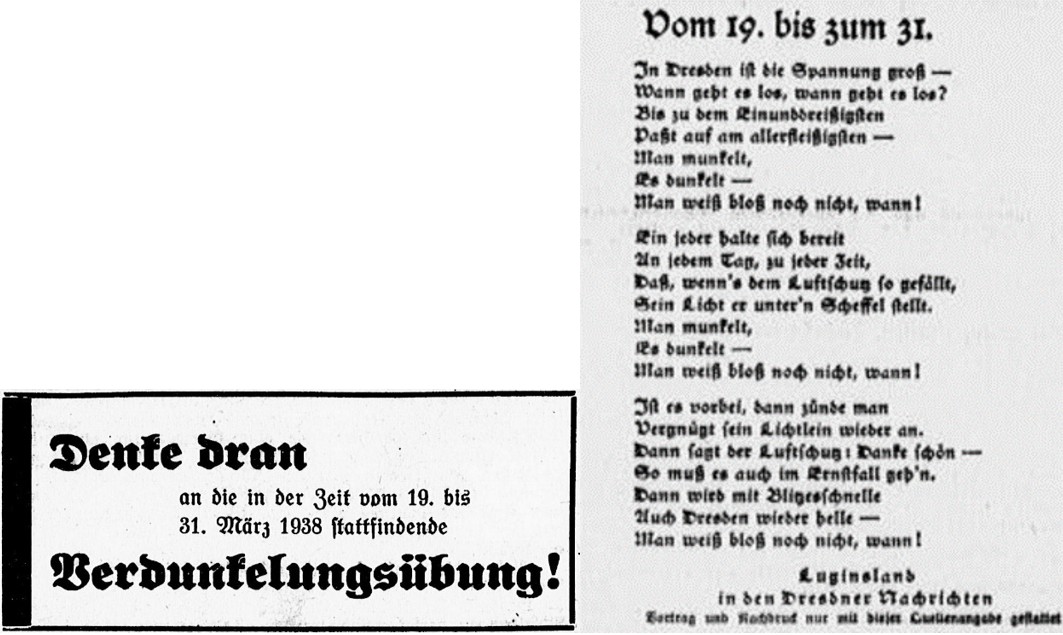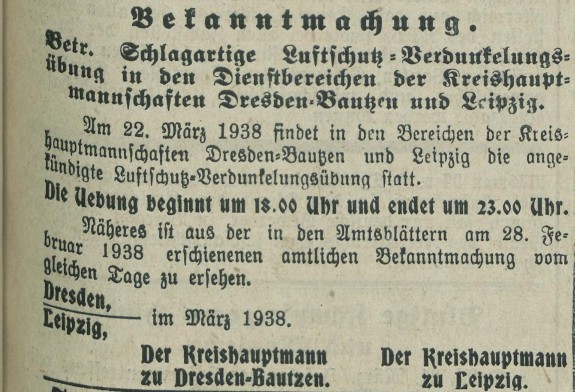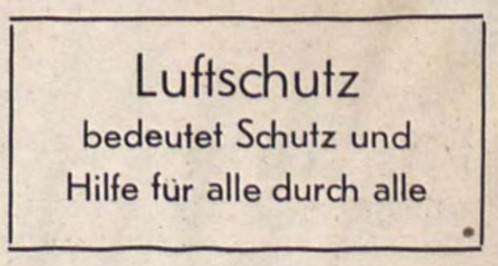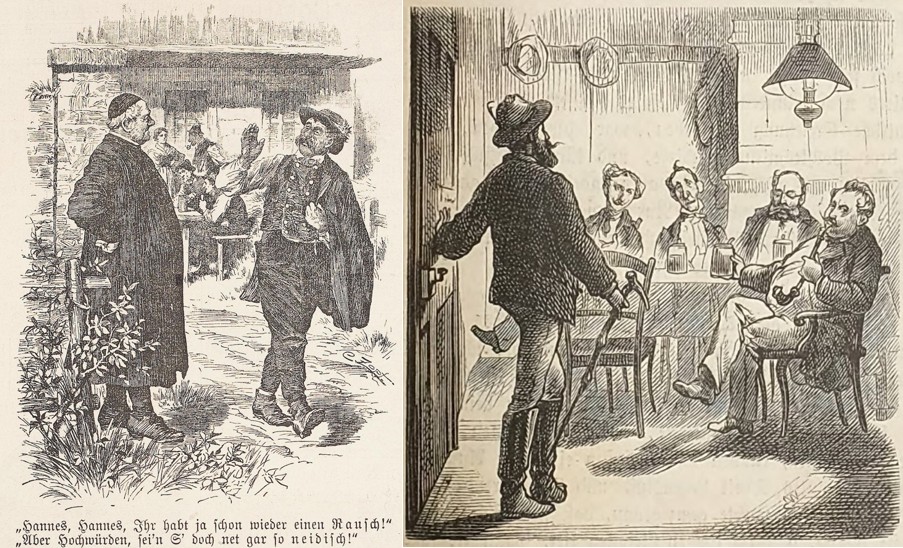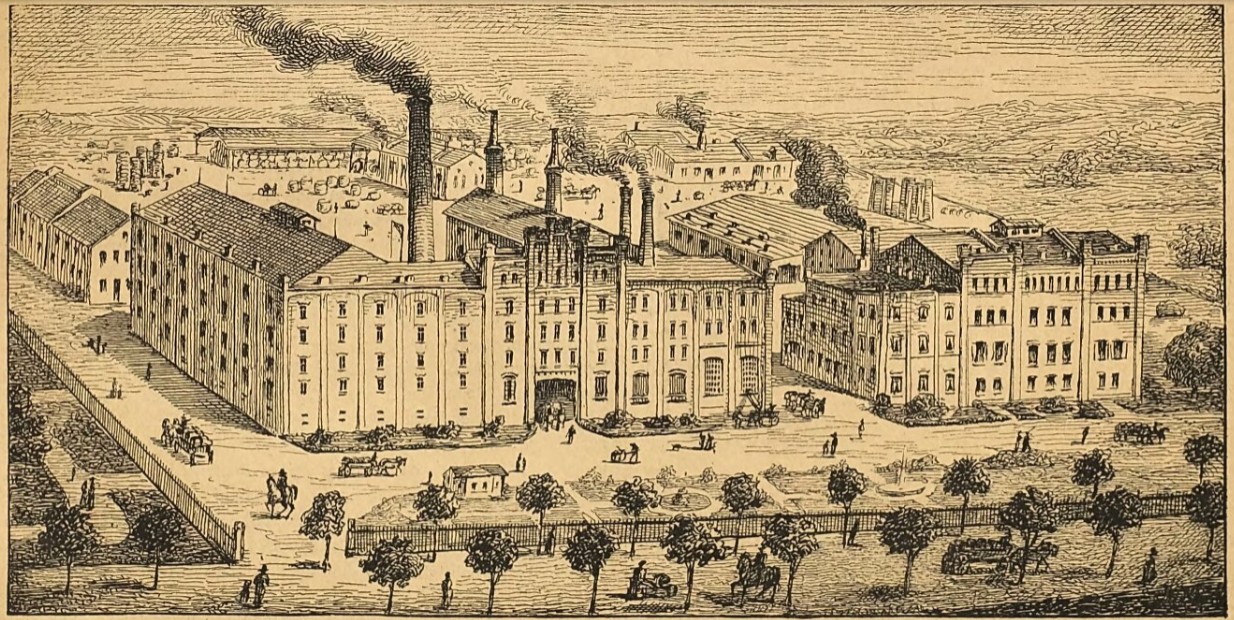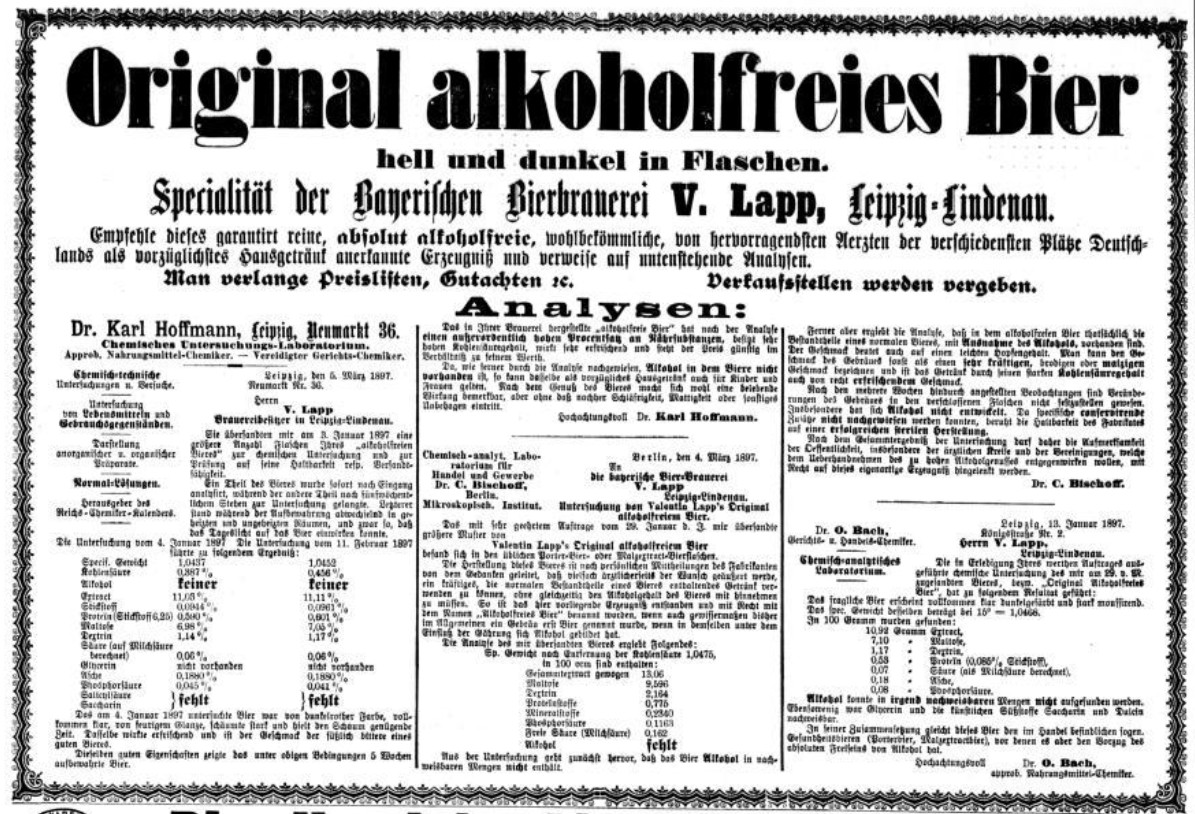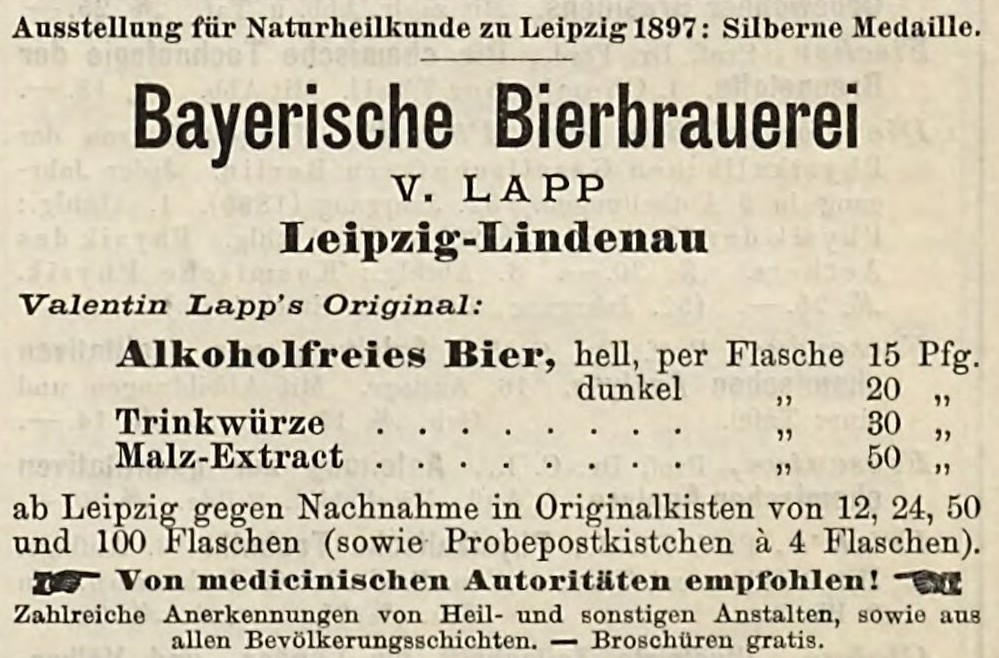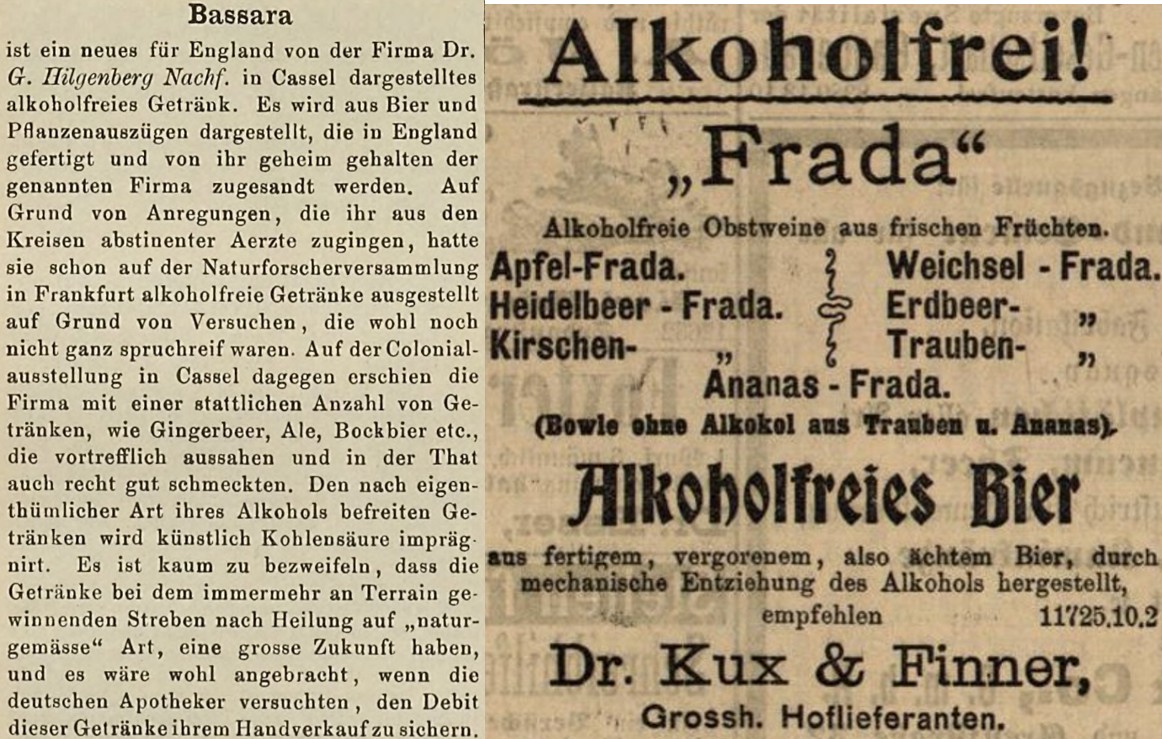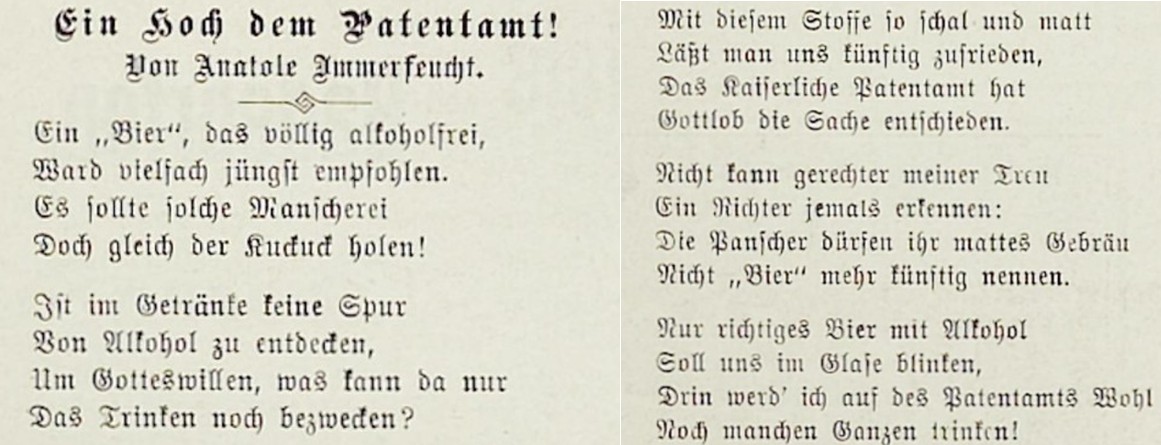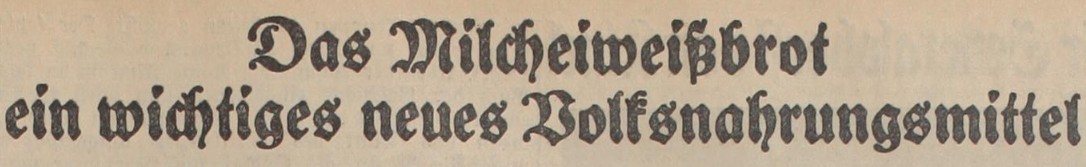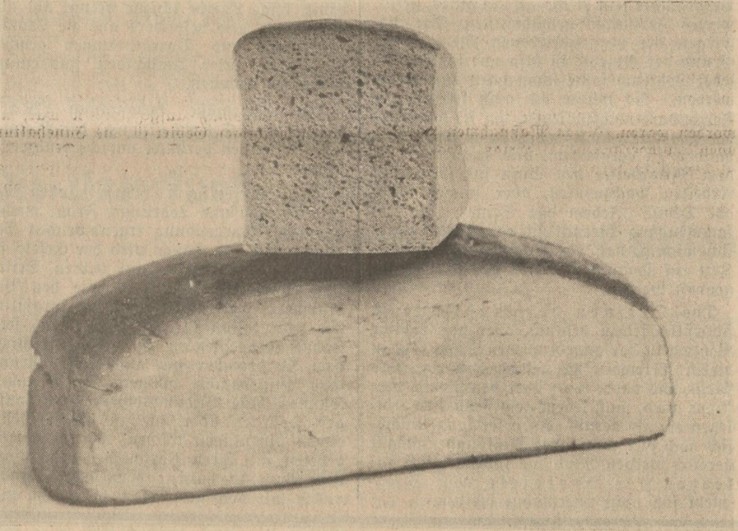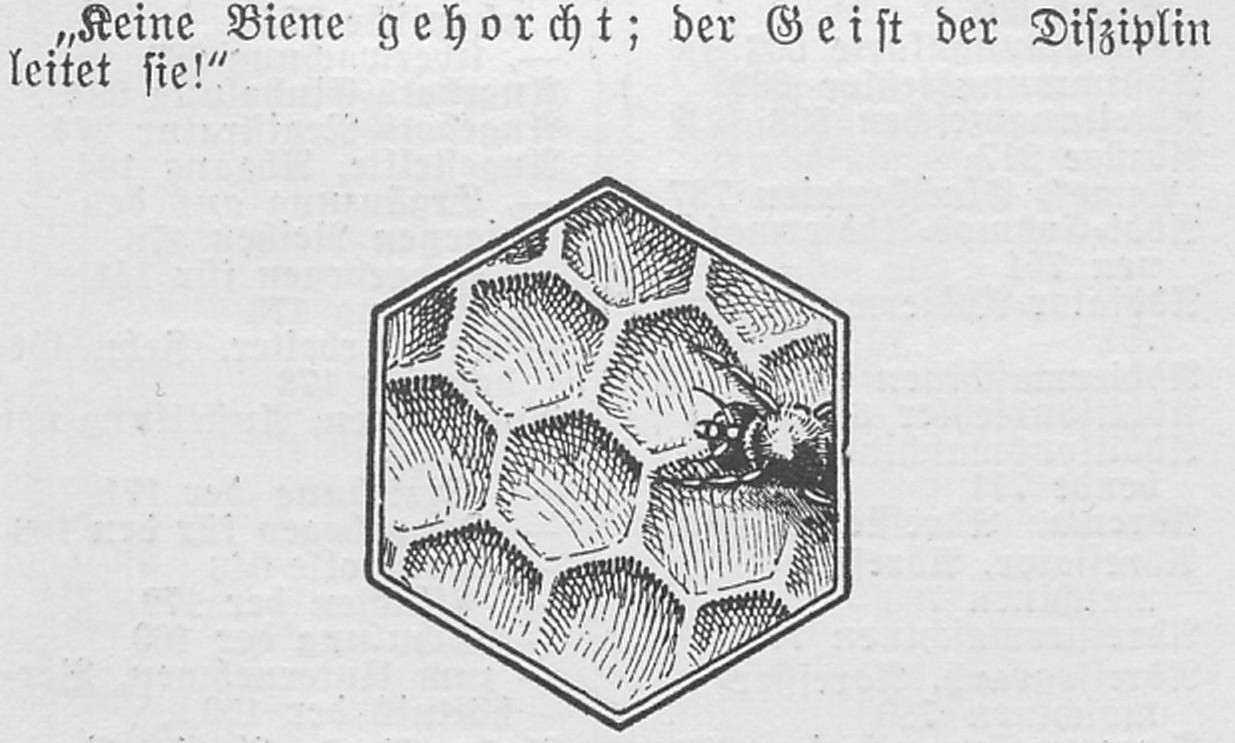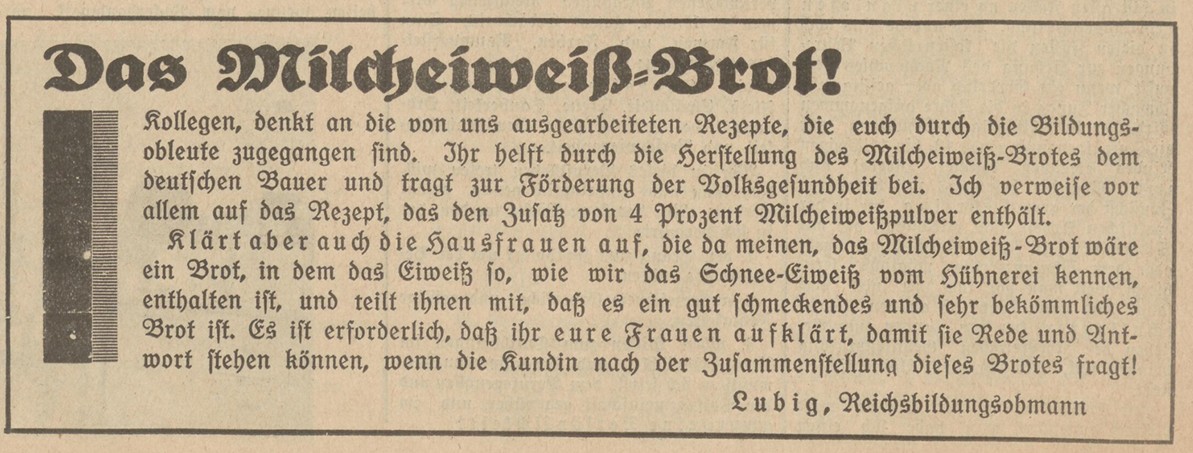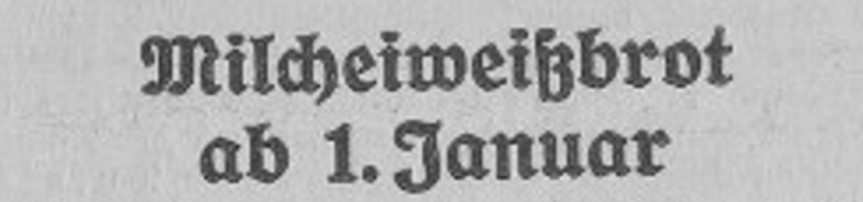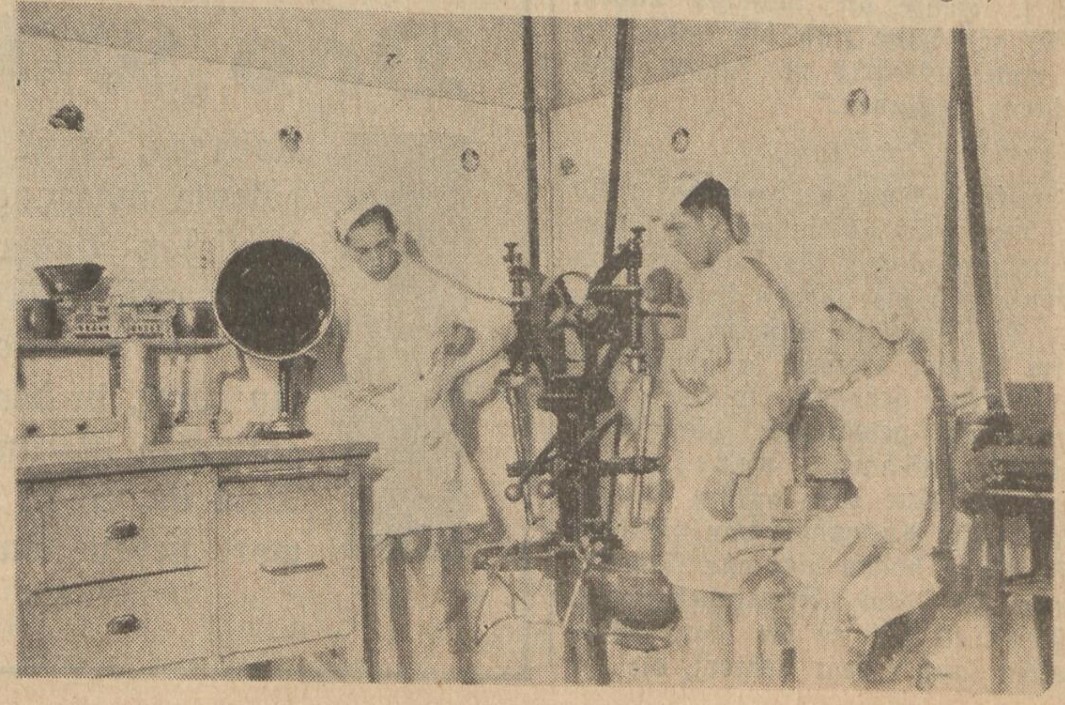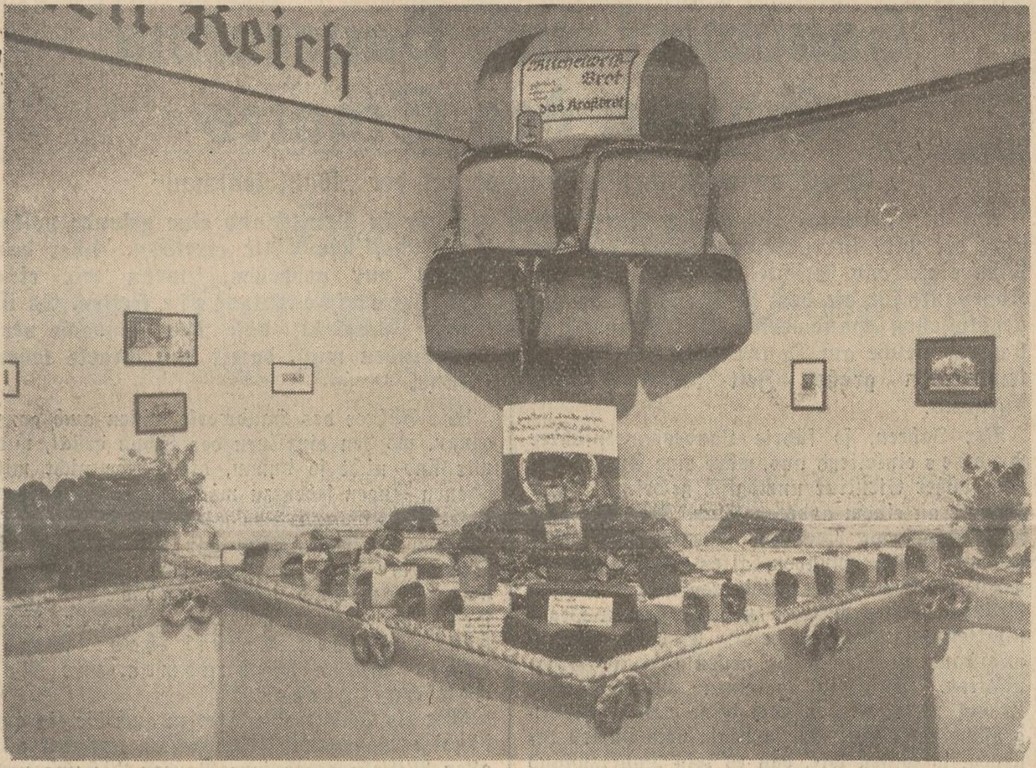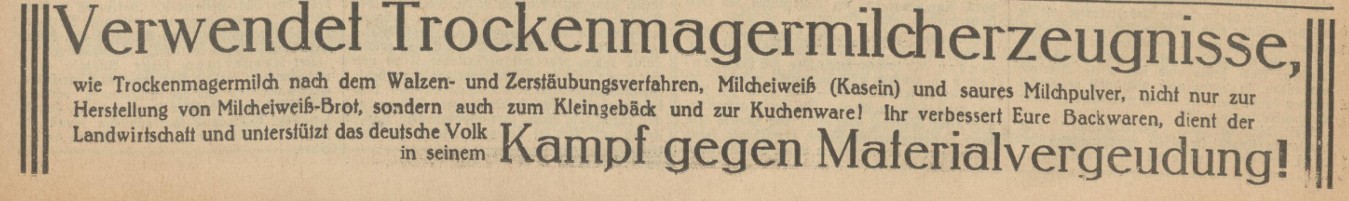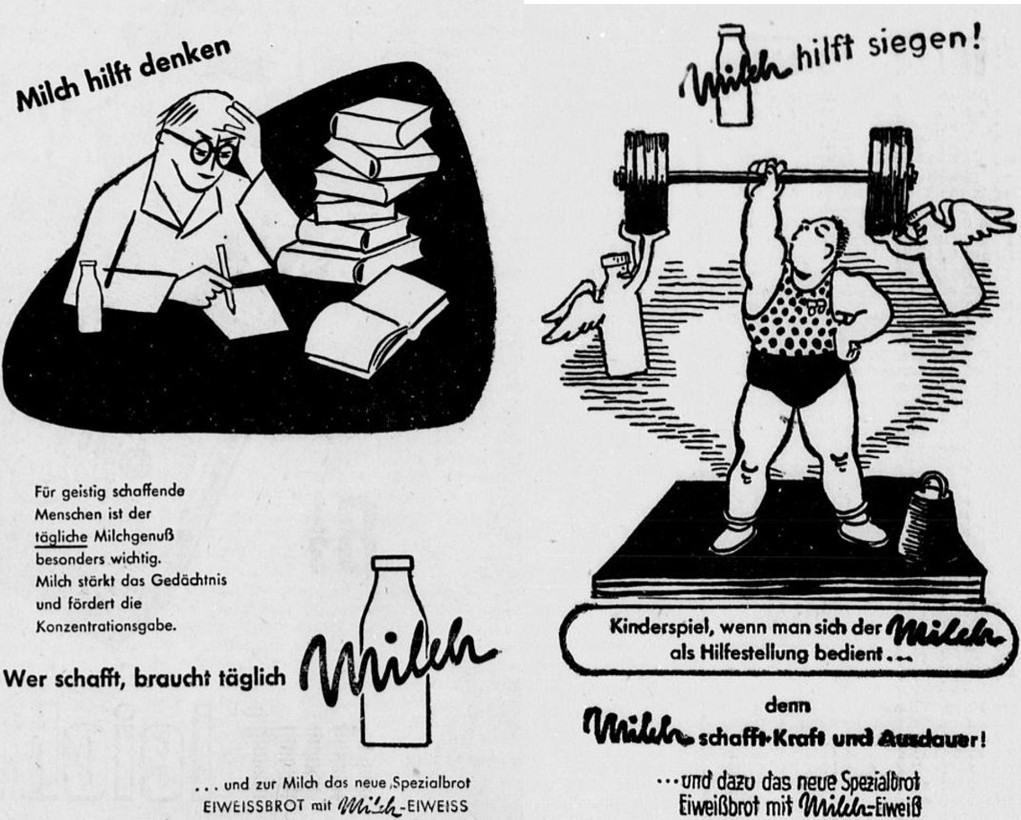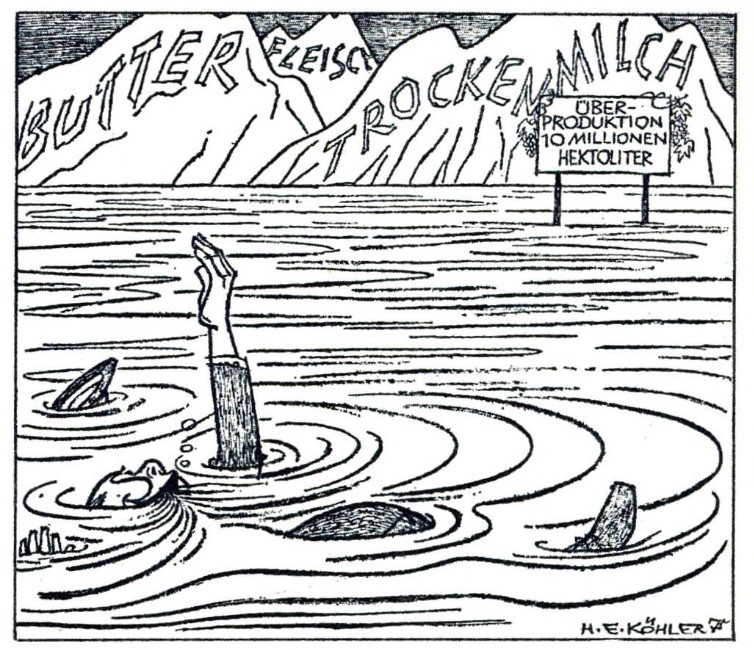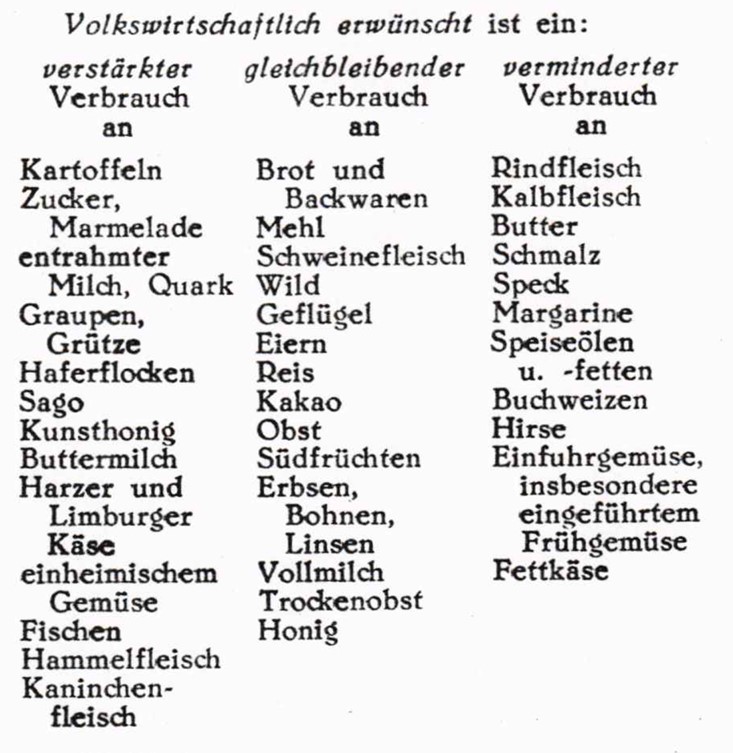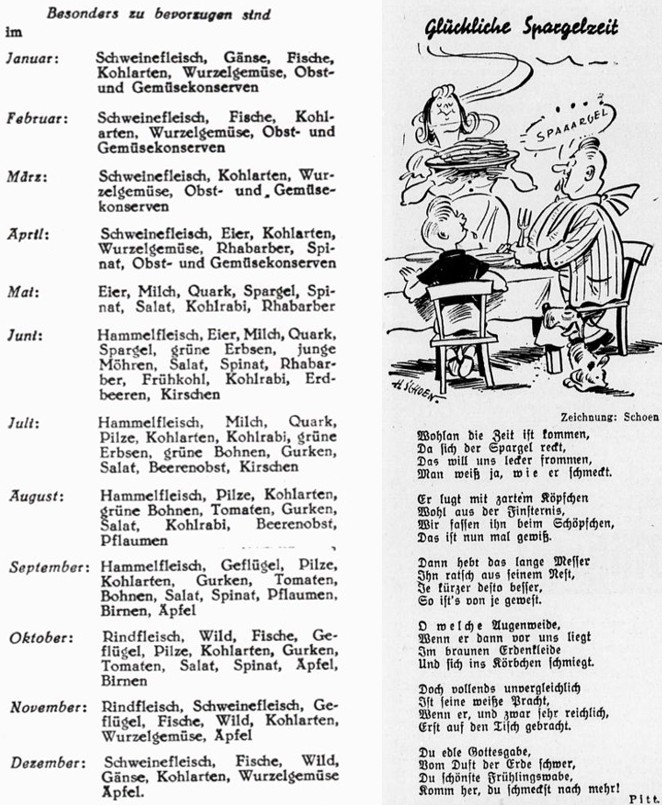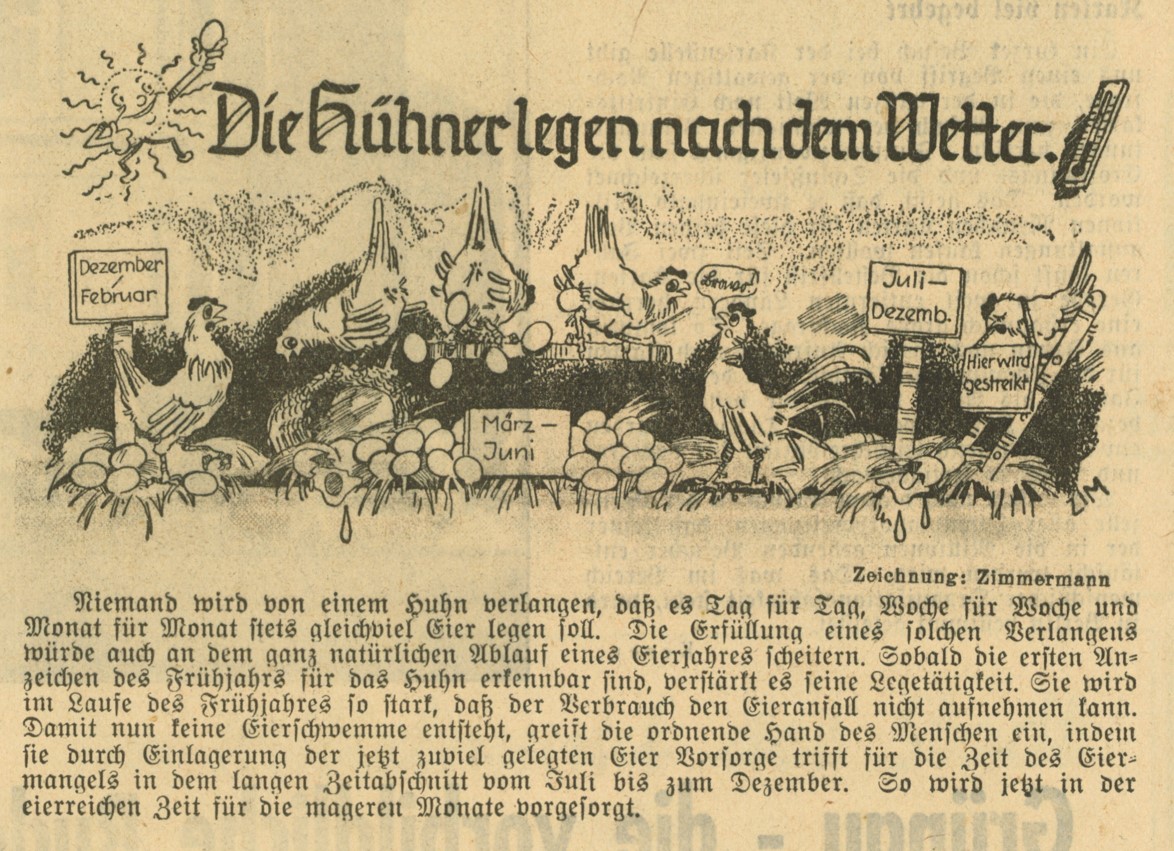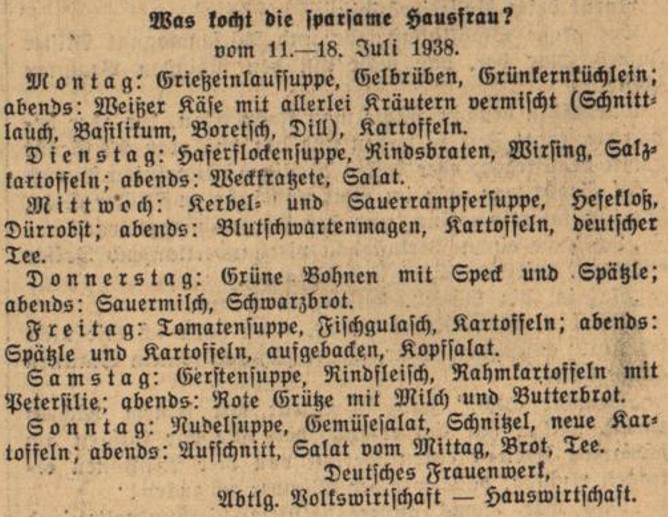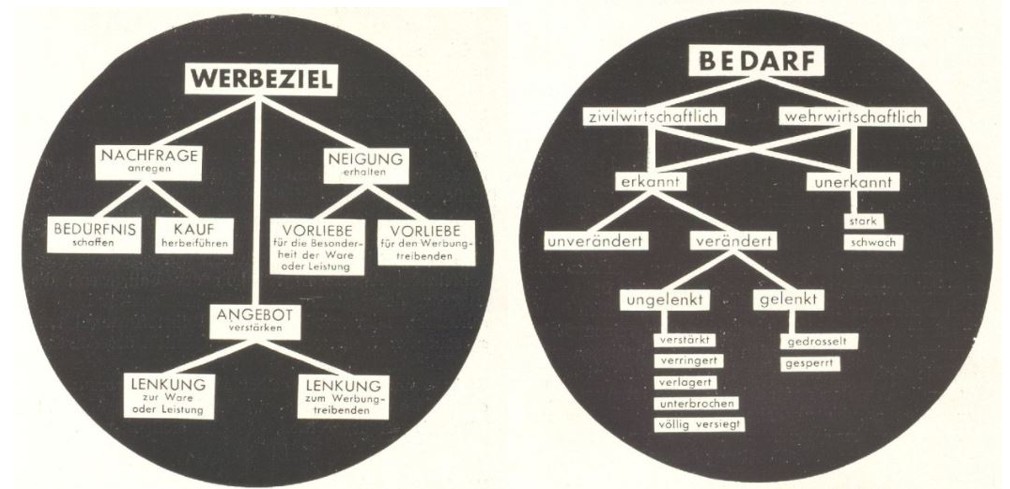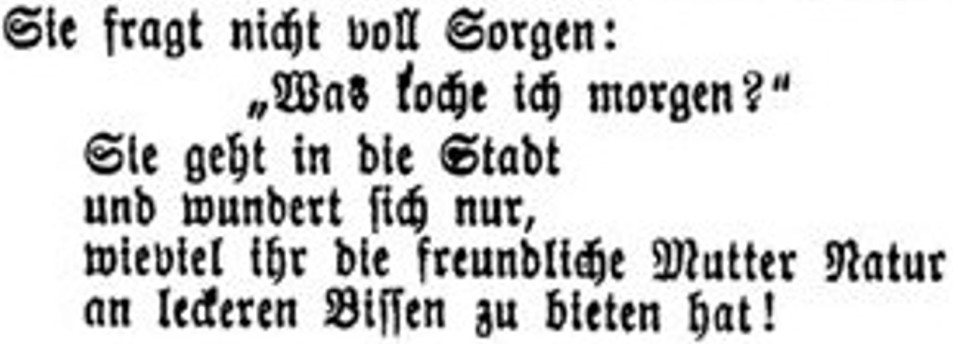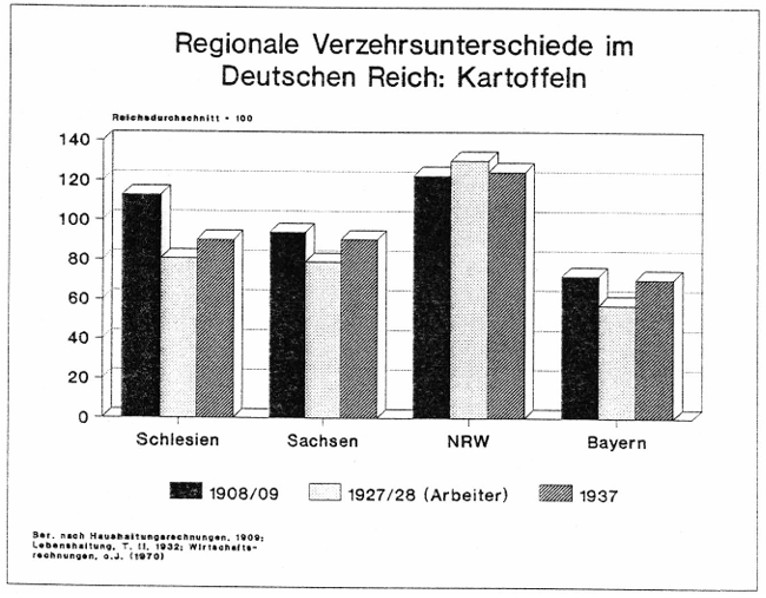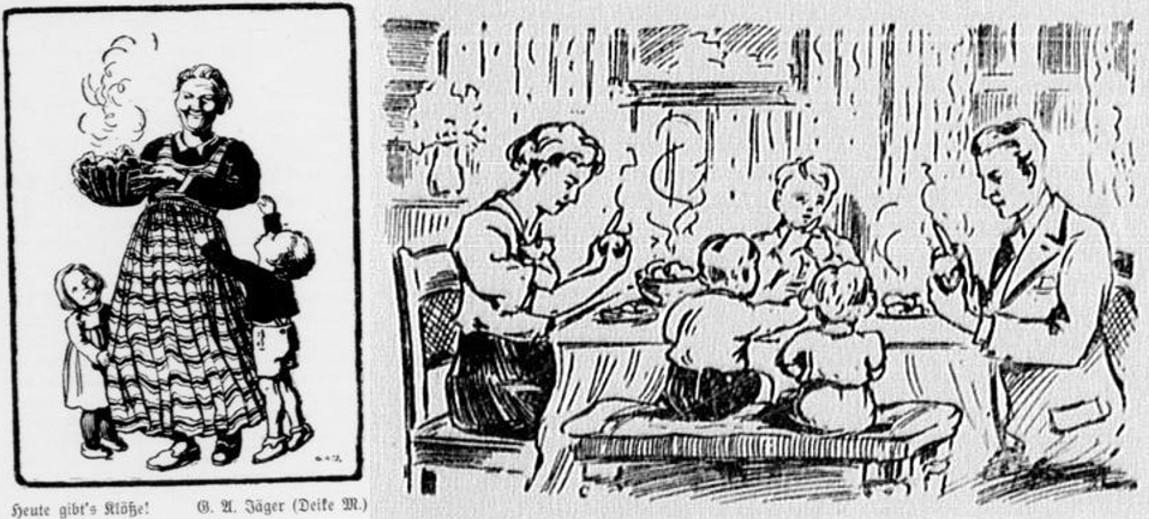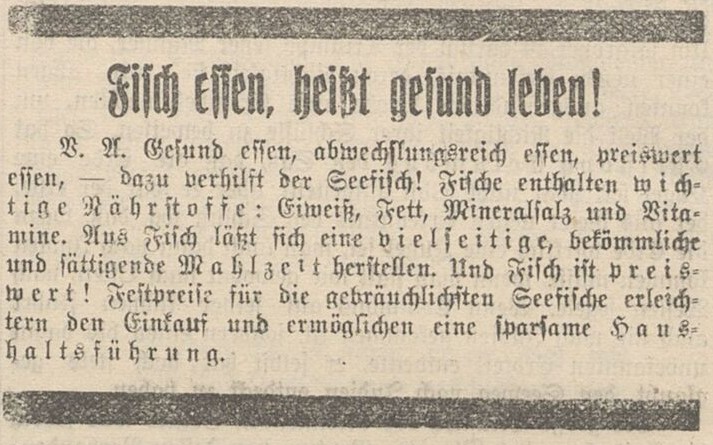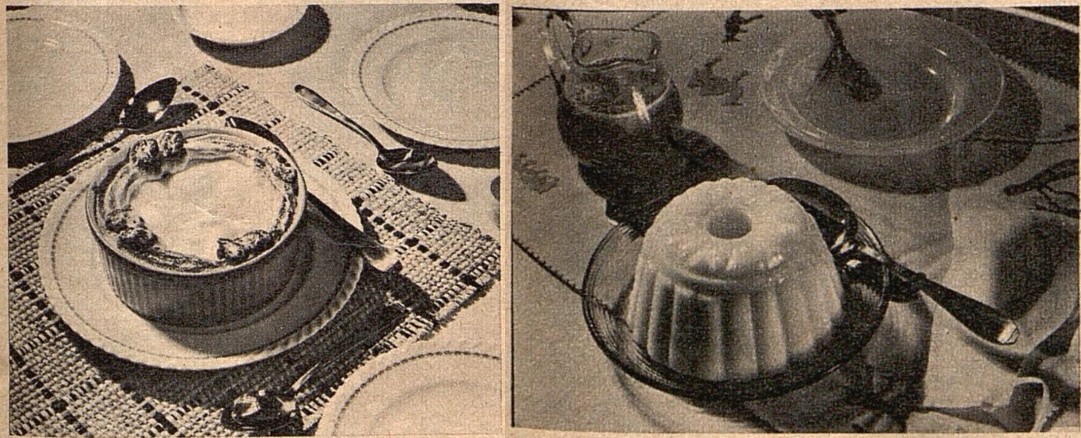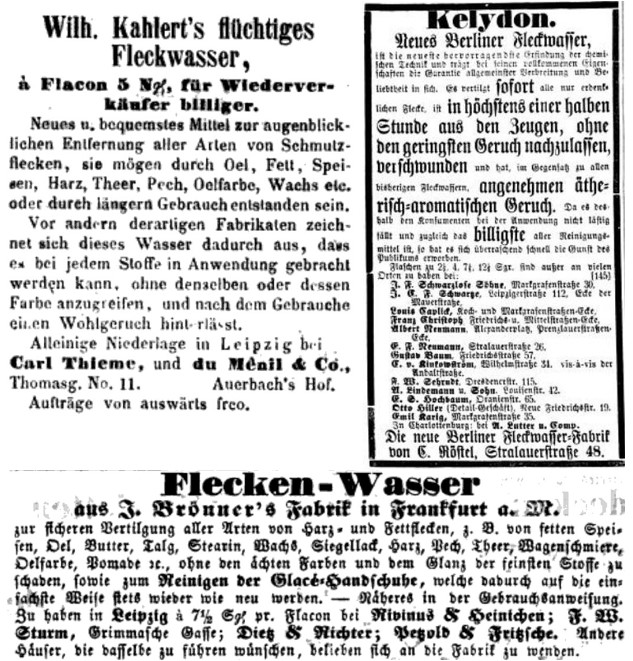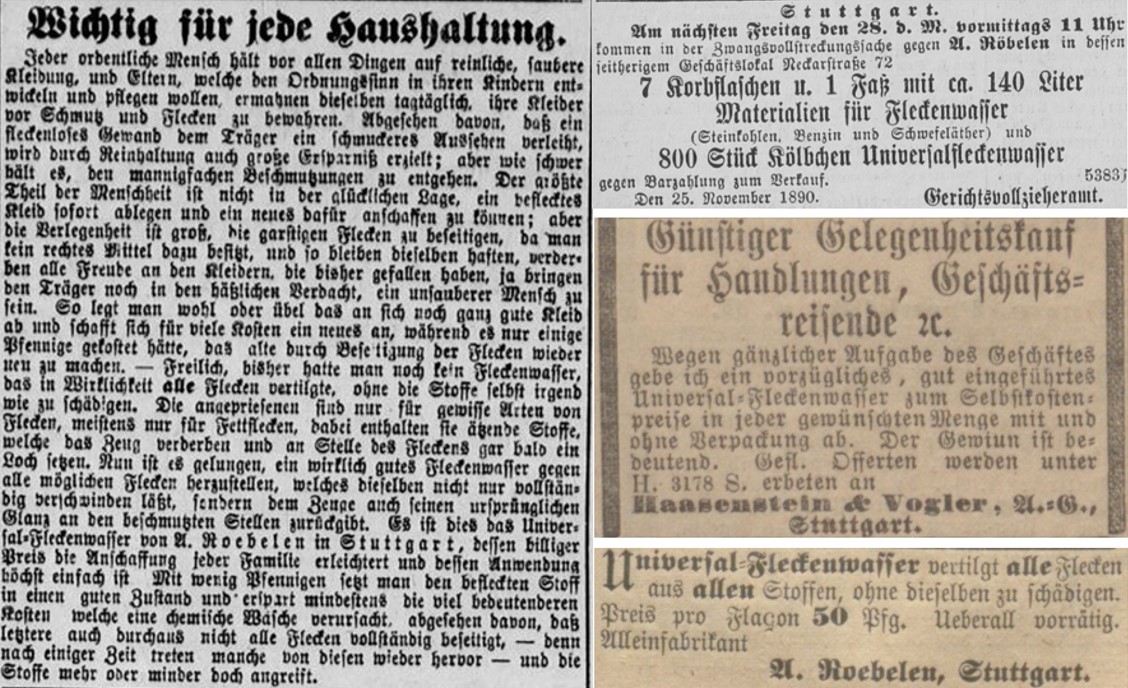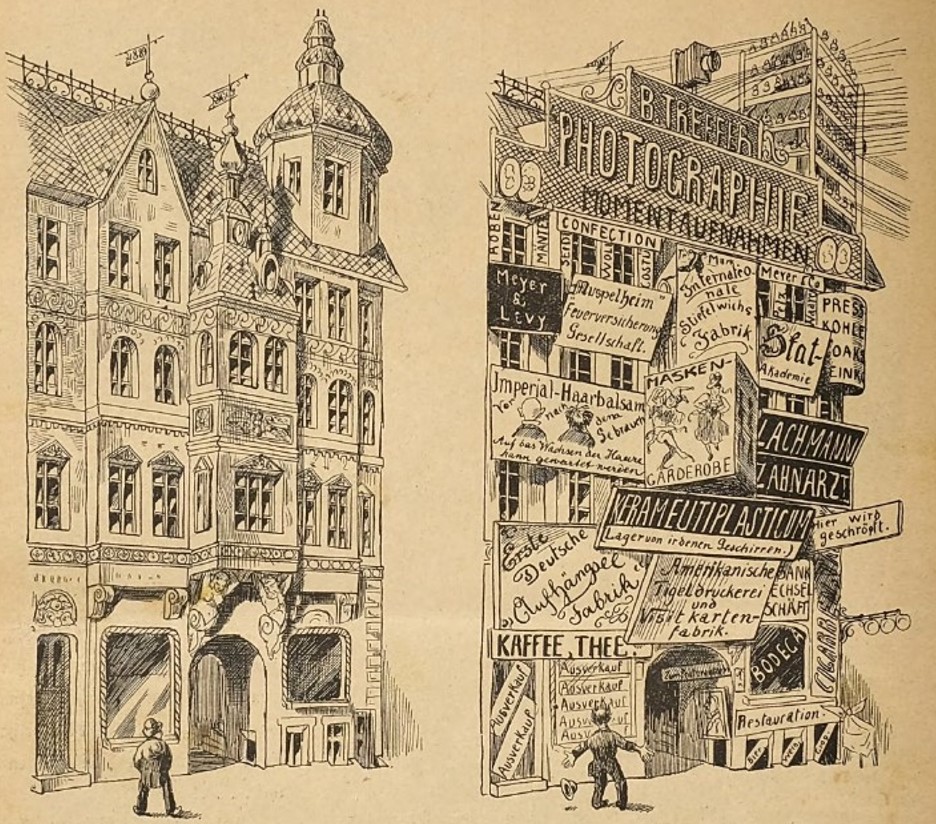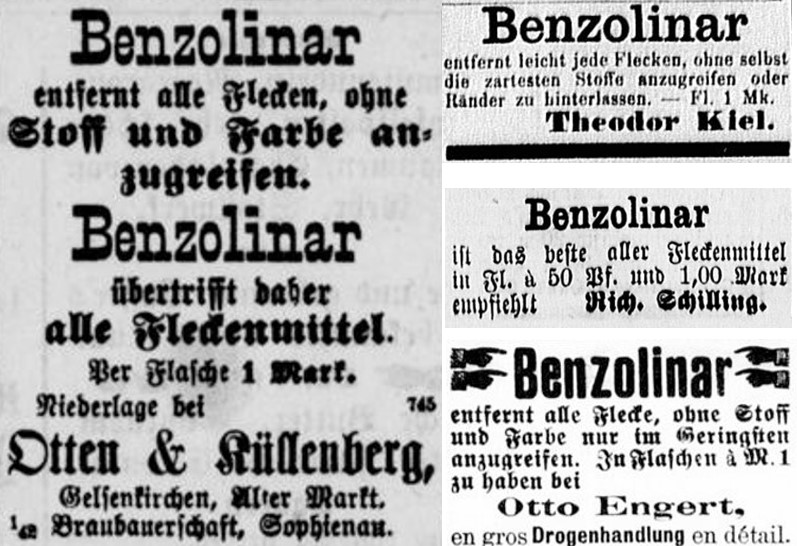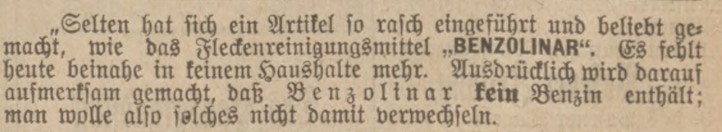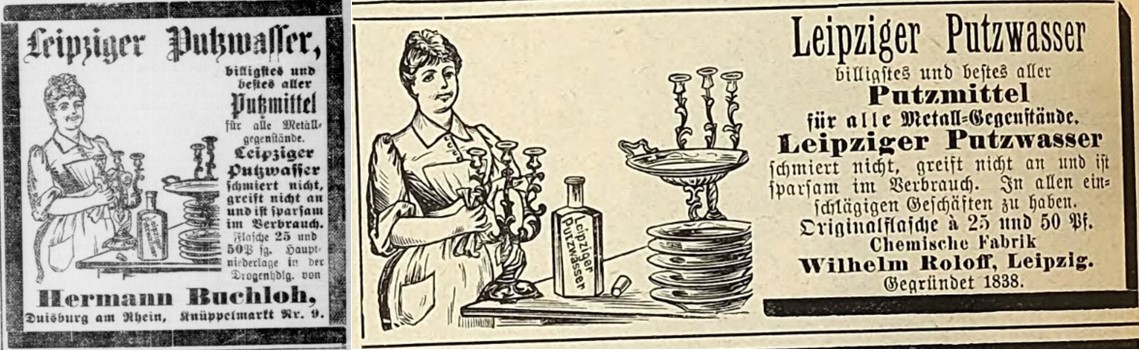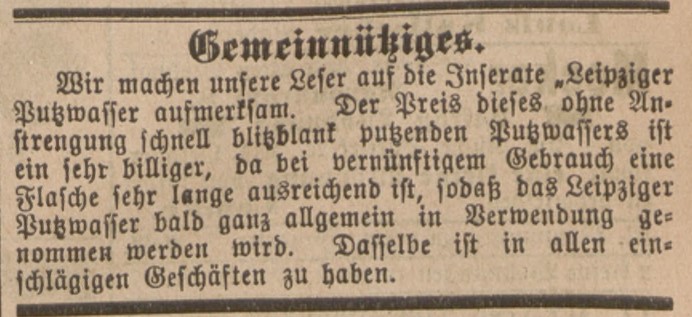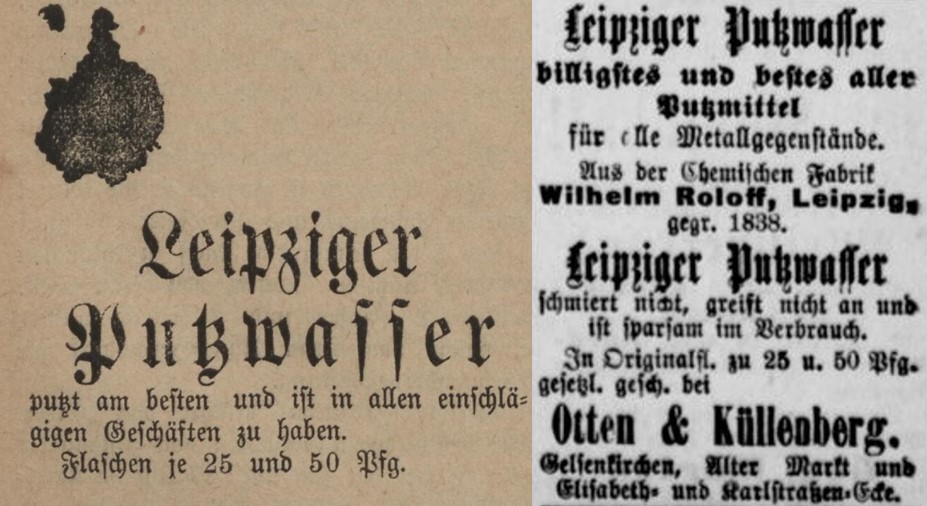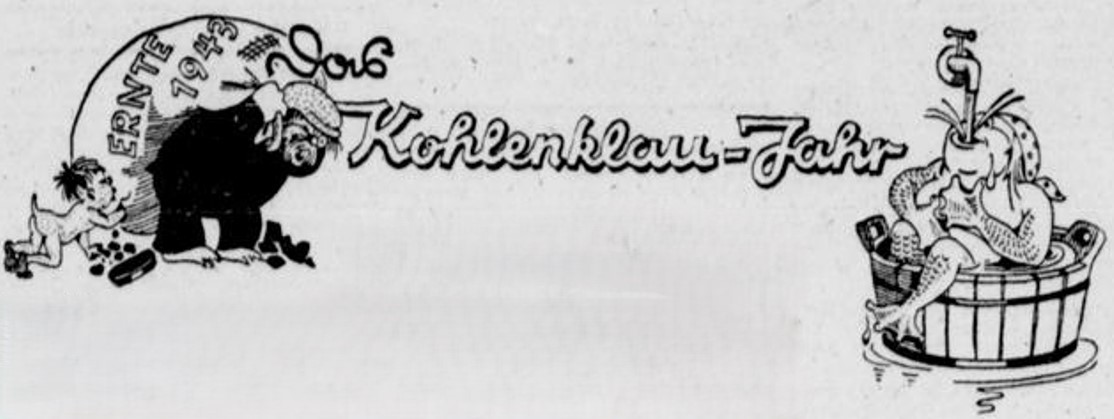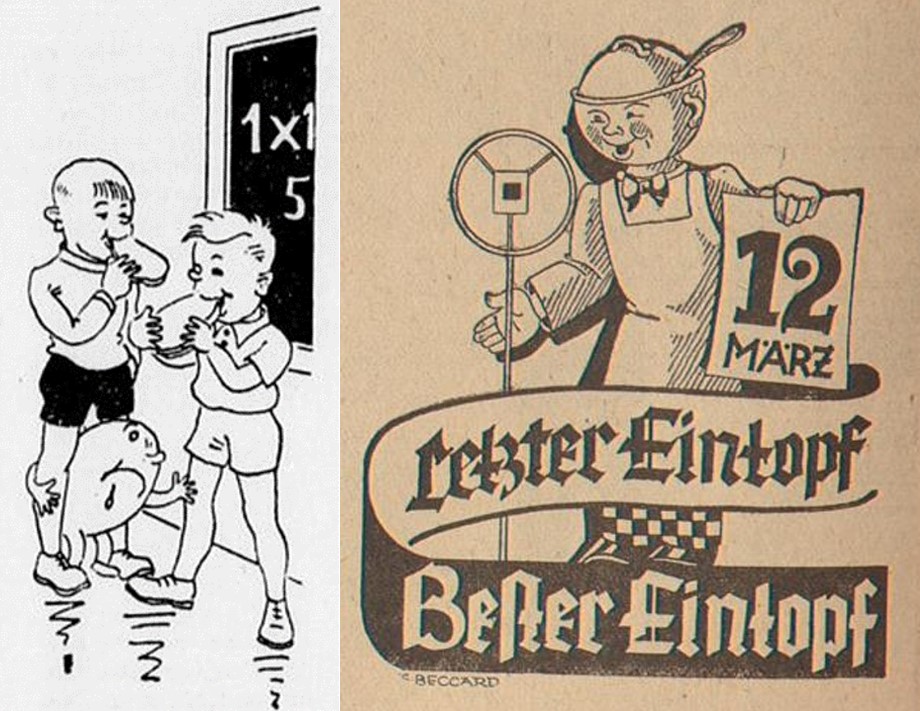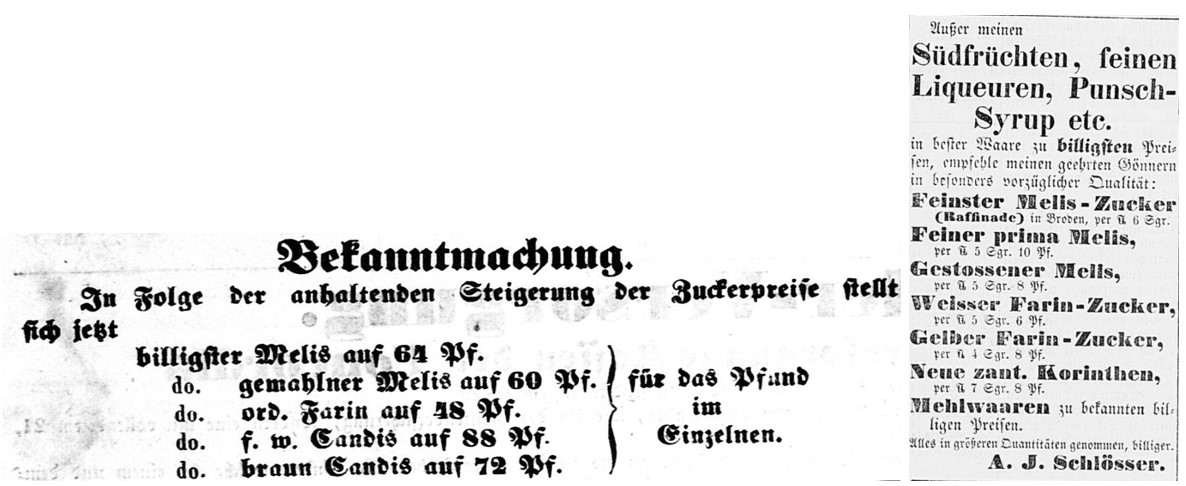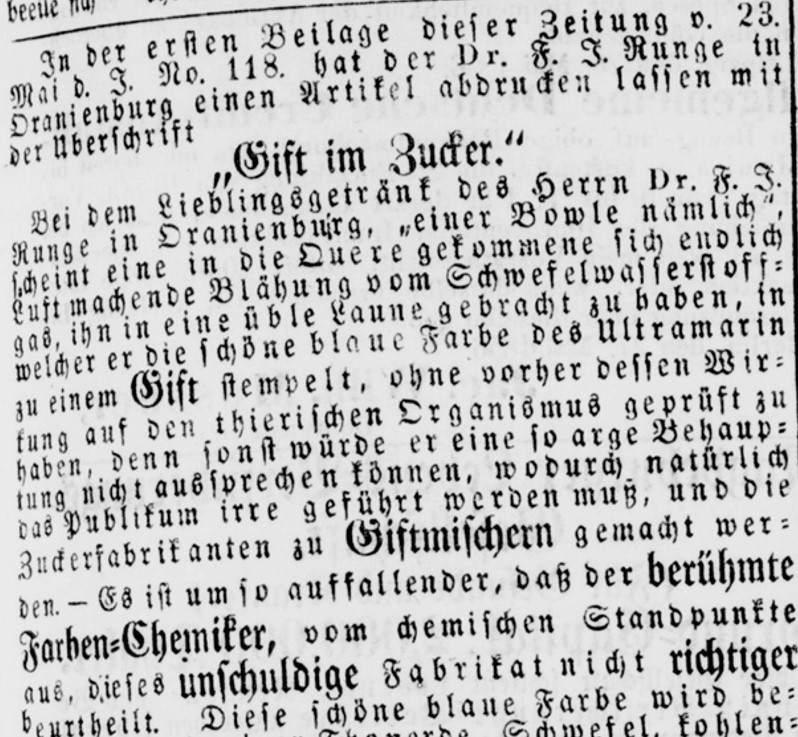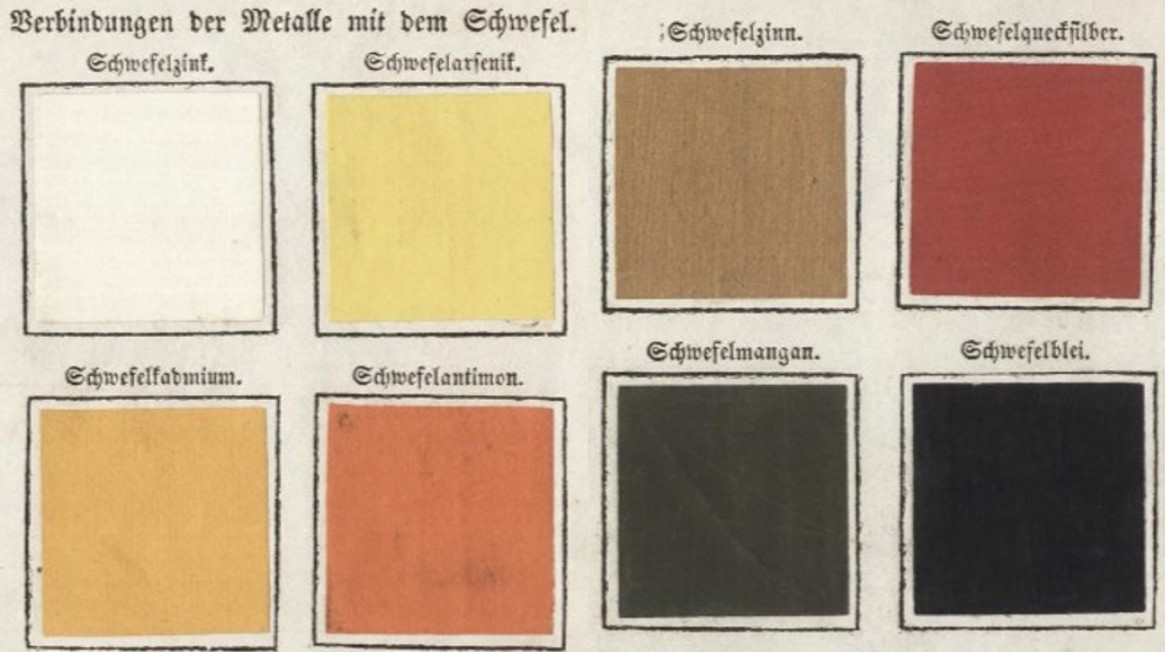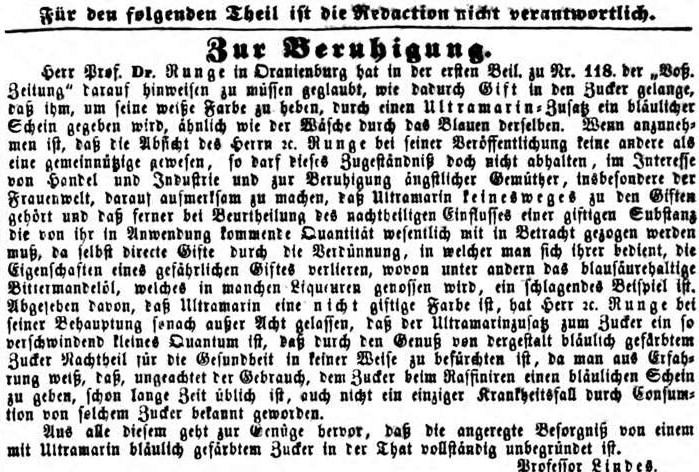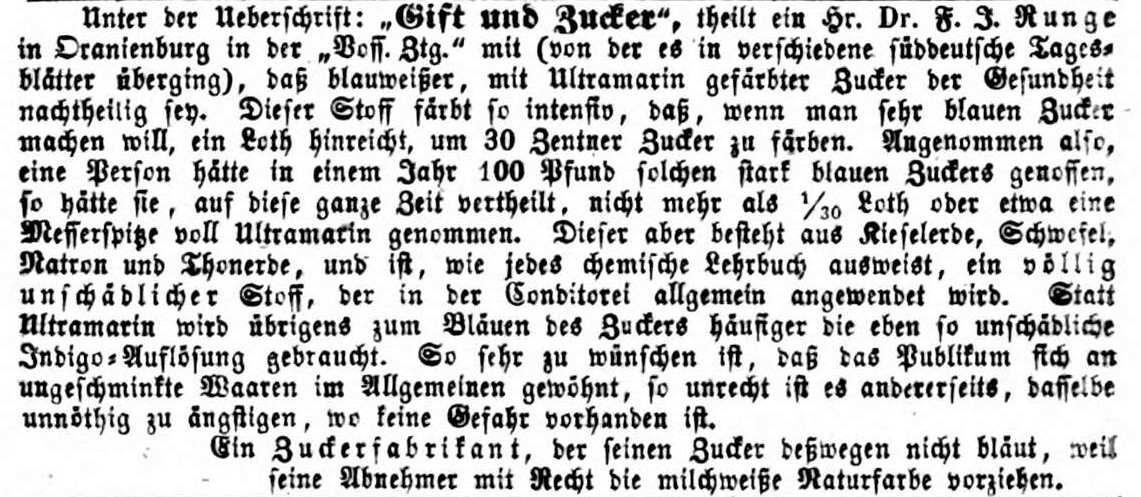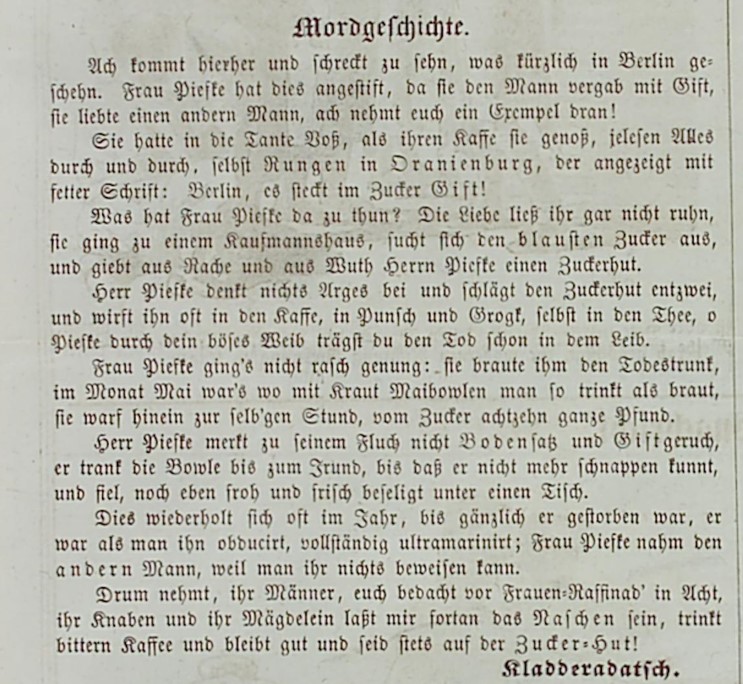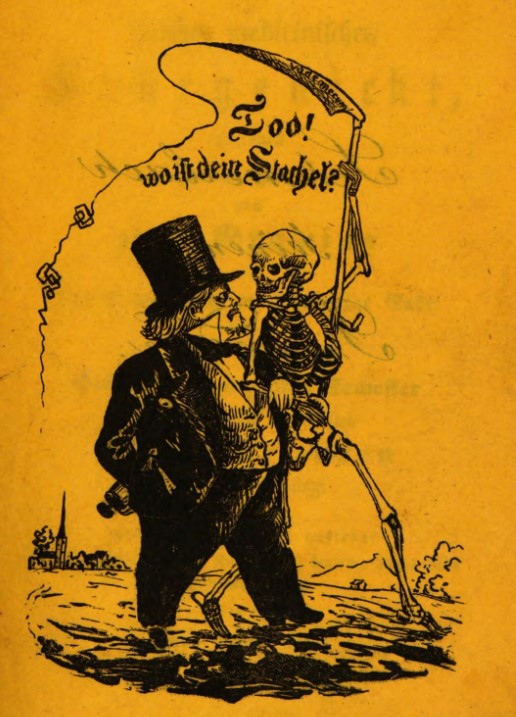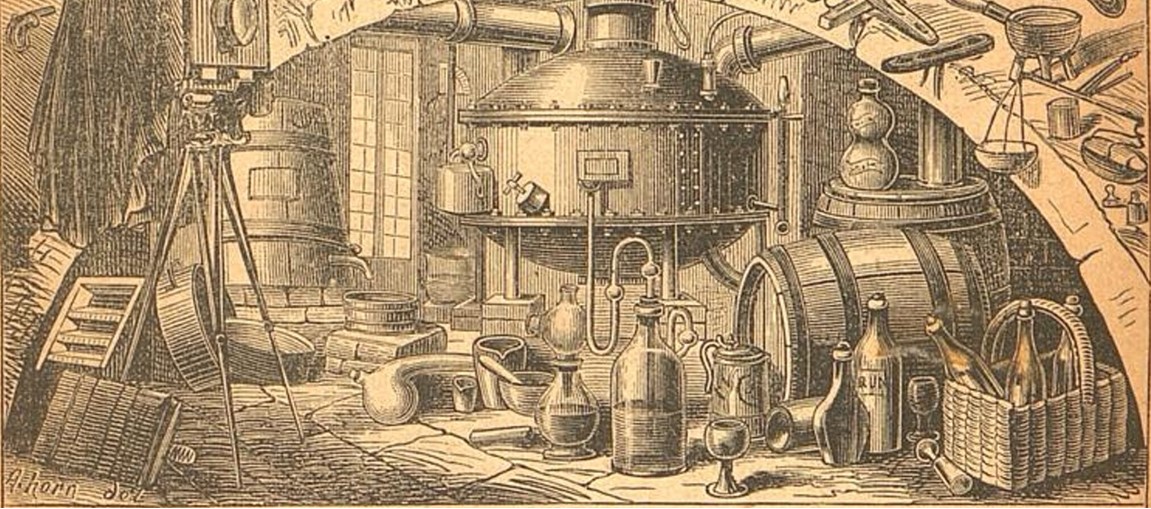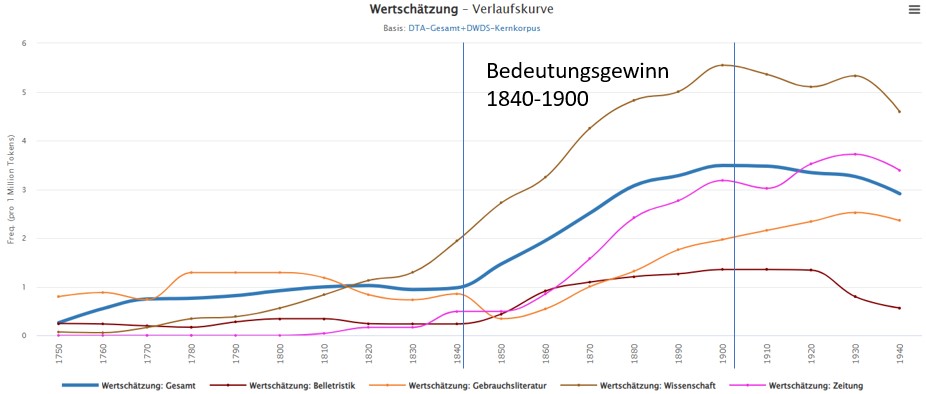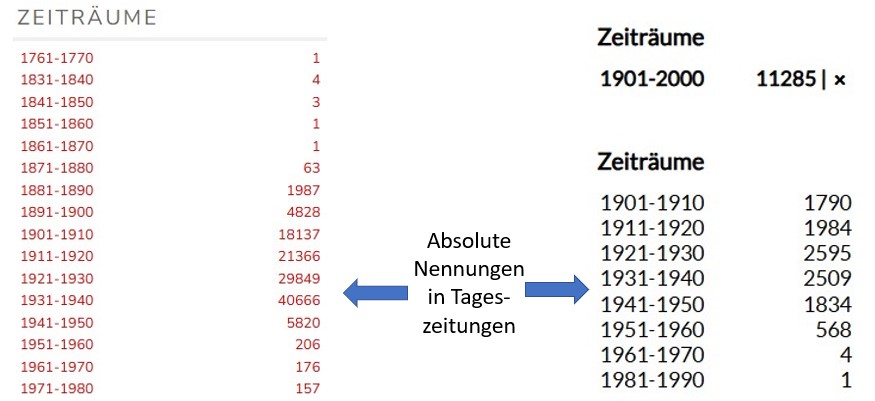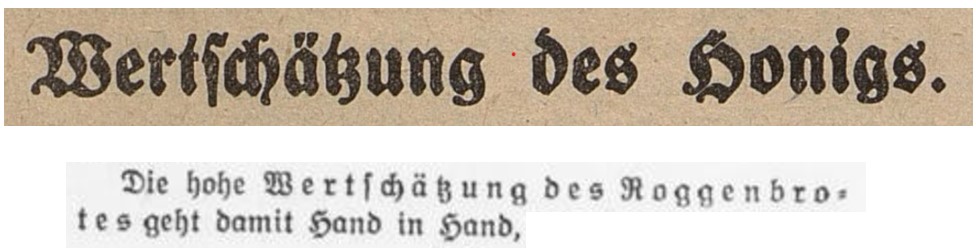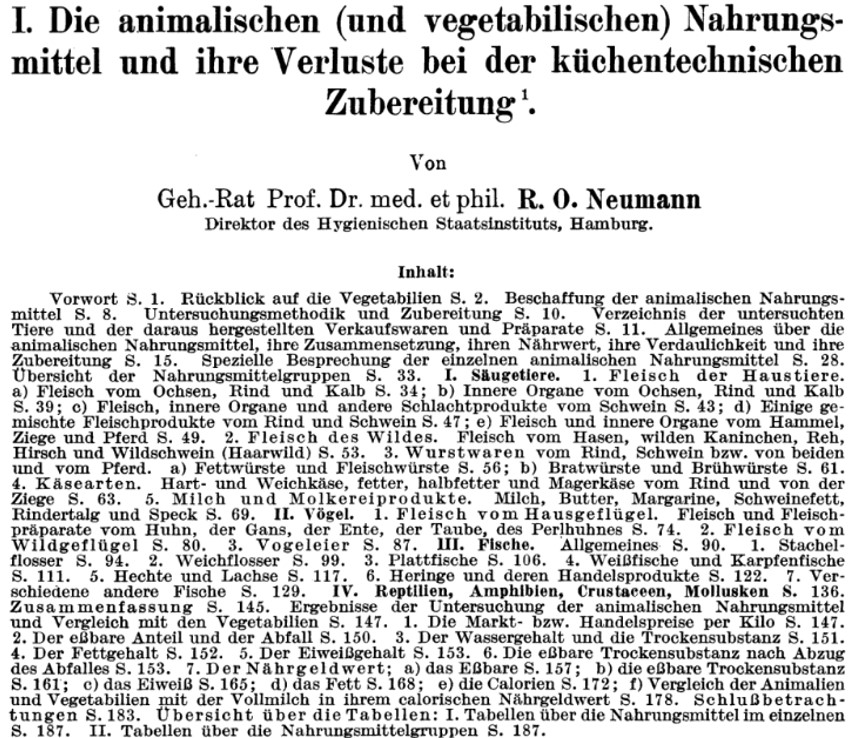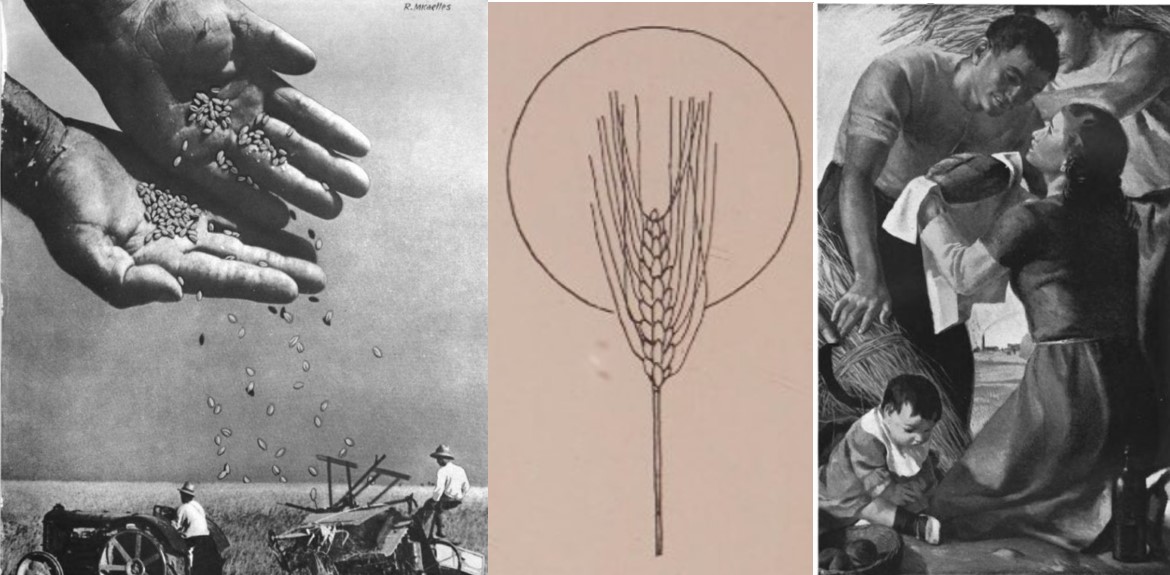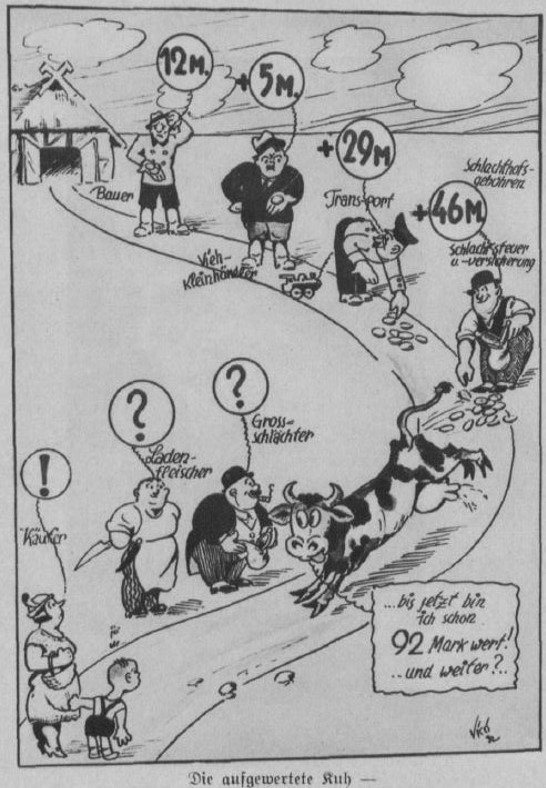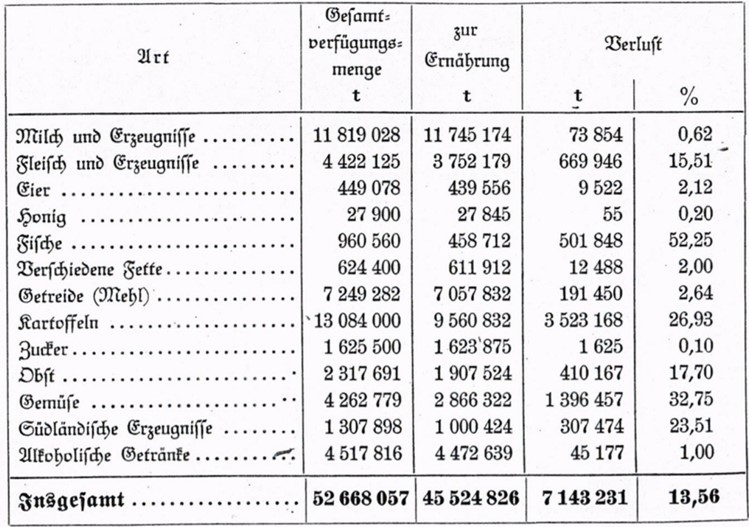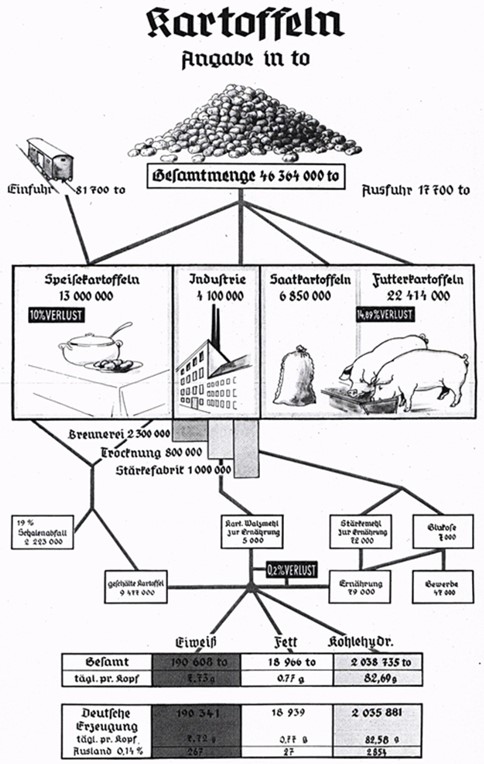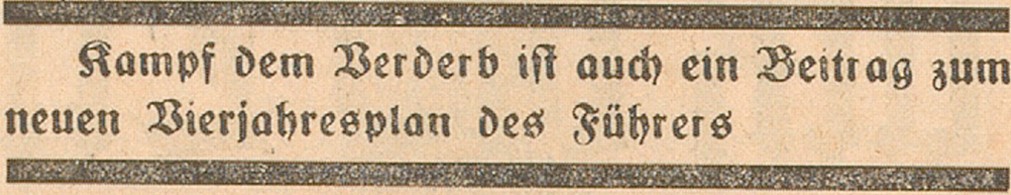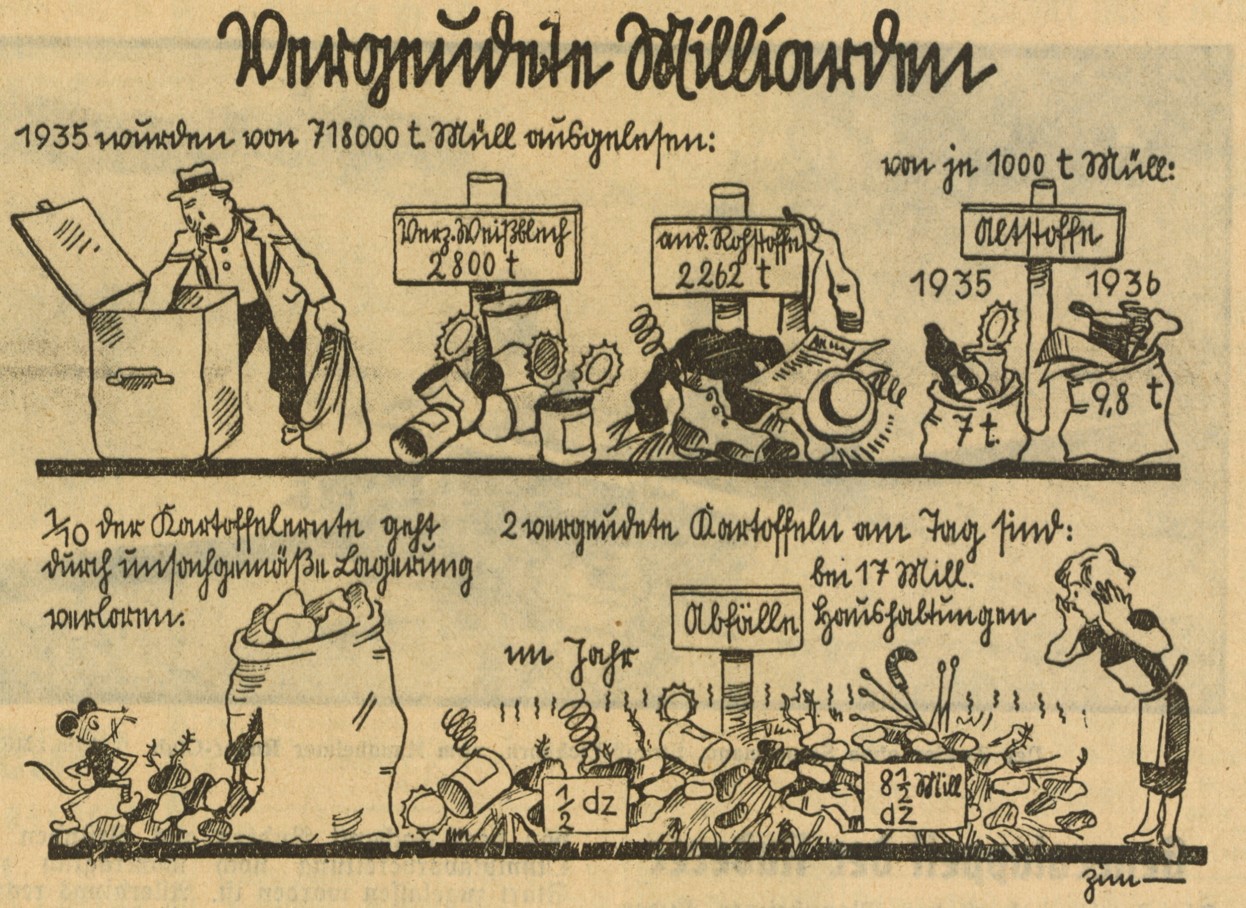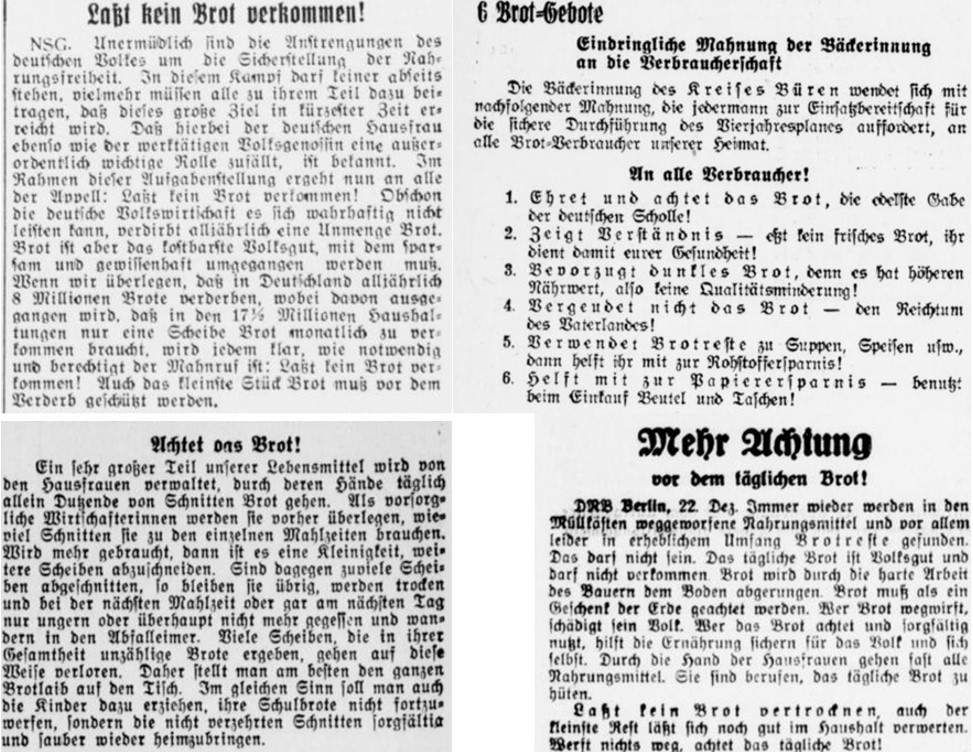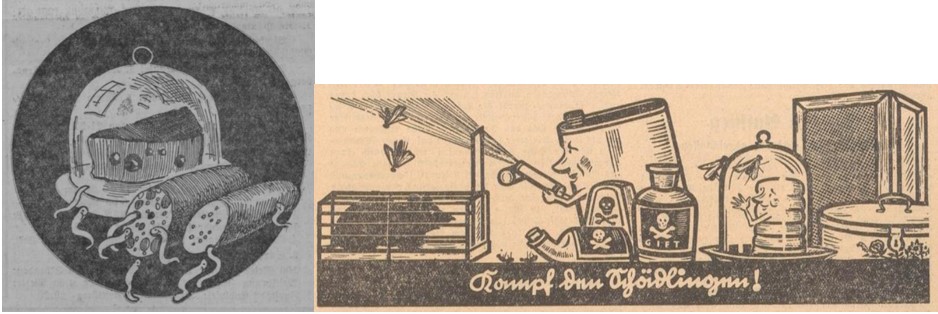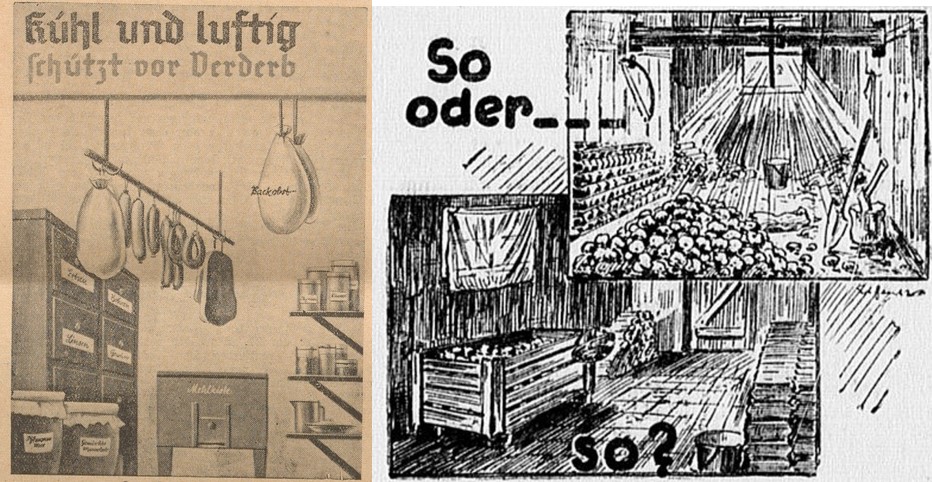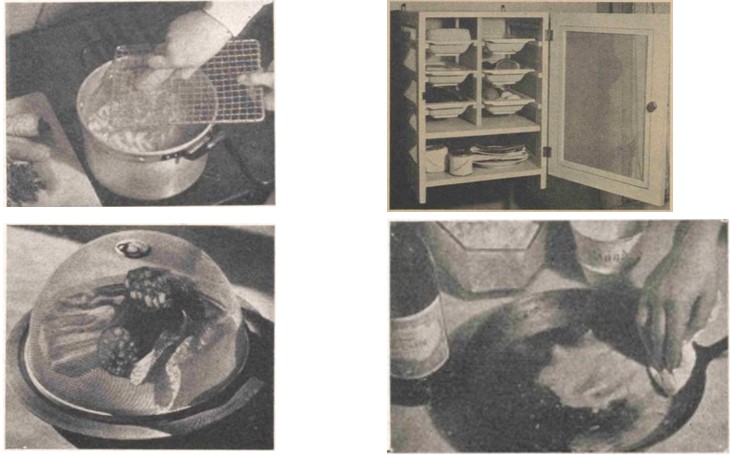Um 1900 konnte man mit alkoholfreien Getränken eine schnelle Mark machen. Kohlensäure, Essenzen und Aromastoffe ermöglichten neuartige Angebote, die neben Wasser, tradiertem Fruchtsirup, die Heilwässer und Heißgetränke traten. Seit 1896 entstanden zudem alkoholholfreie Weine und auch alkoholfreie Biere. Sie waren teils Werbefiktionen, entsprachen vor allem geschmacklich nur selten den alkoholhaltigen Originalen. Doch Alkoholika wurden damals verstärkt in Frage gestellt, Mäßige und Abstinente forderten eine Nüchternheitswende – und der Markt, viele Tüftler und Geschäftsleute lieferten. Sie agierten in einem gestalterischen Möglichkeitsraum, denn die uns geläufigen Produktkategorien waren noch nicht definiert und staatlich reguliert. Die Nichtalkoholika spiegelten und materialisierten denn auch die tiefgreifenden wirtschaftlichen, sozialen, wissenschaftlichen und technologischen Brüche der Jahrhundertwende, des Fin de Siècle.
Die soziale Frage dominierte die Politik, der Gegensatz zwischen Arbeit und Kapital überwölbte und verdrängte die autoritäre Ordnung der ständischen Gesellschaft. Die Ernährungswissenschaften hatten tradierte Vorstellungen über richtiges Essen (und Trinken) in Frage gestellt. Das Wissen um chemische Stoffe und den Stoffwechsel in Pflanzen, Tieren und Menschen erlaubte überzeugende, „gesunde“ Alternativen. Neu entwickelte Maschinen ermöglichten Eingriffe in das Innere der nun gewerblich umgestaltbaren Natur. Seit den 1860er Jahren nahm die Zahl neuartiger Lebensmittel rasch zu, Rübenzucker und Säuglingskost, Margarine und Suppenpräparate sind nur plakative Beispiele für eine große und wachsende Palette immer neuer Angebote. Auch die Getränke veränderten sich: Seit den 1820er Jahren kam der Kartoffelschnaps, der „Branntwein“ auf, und das tradierte Bier veränderte sich seit den 1870er Jahren zu einem zuvor kaum denkbaren standardisierten Produkt. Auch Nichtalkoholika blieben vom Malstrom der Umgestaltung nicht unberührt: Die zunehmend separierte, gefilterte, auf hohen Fettgehalt optimierte und teils auch pasteurisierte Milch unterschied sich deutlich vom Melkertrag früherer Zeiten. Ähnliches galt für die „künstlichen“, mit Kohlensäure prickelnd gehaltenen Mineralwässer, die gegenüber ihren „natürlichen“ Namensvettern Geschmacks- und Haltbarkeitsvorteile hatten. Während aber in Großbritannien und den USA auch „Soft Drinks“, also kunstfertige Mischungen aus Wasser, Kohlensäure, Kräuterextrakten, Aromen, Zucker und Süßstoffen entstanden – Tonic Water und Coca-Cola sind bekannte Beispiele –, blieb dieses Marktsegment in Mitteleuropa unterentwickelt. Teurer Zucker, das Hausbrauen, ein weniger strikt agitierender Protestantismus und die vermeintlich „schwache“ Natur dieser Getränke bieten Erklärungen.
Der Aufschwung der alkoholfreien Getränke um die Jahrhundertwende war demnach eine nachholende Entwicklung. Sie verlief entsprechend stürmisch, schuf zugleich Wildwuchs und Marktverwerfungen. In dem neuen Marktsegment wurden nicht einfach Getränke entwickelt und verkauft, sondern zugleich Träume von Gesundheit und Nüchternheit. Das lockte Investoren, Techniker und Wissenschaftler: Hier war Neuland zu gewinnen, Vermögen anzuhäufen, ein späteres ehrsames Leben als wohlsituierter Erfinder und Unternehmer möglich.
Hopkos war eines der bekanntesten Beispiele dieser ersten Welle alkoholfreier kohlensäurehaltiger Getränke, die langfristig die hiesigen Trinkgewohnheiten tiefgreifend umgestalten und neue Probleme schaffen sollten. Doch Hopkos verkörperte erst einmal Fortschritt, zielte auf ein neues besseres Leben. Es wurde als Bierersatz vermarktet, gar als alkoholfreies Bier, schließlich bestand es – so die lockende Werbeaussage – aus Hopfen und Malz. Wohlschmeckend und alkoholfrei war es, die Tage des alten, alkoholhaltigen Bieres schienen gezählt. Doch Hopkos verschwand nach ein, zwei Jahren wieder vom Markt, wurde ersetzt durch andere, ähnliche Getränke. Die schnelle Mark machten nur wenige, denn trotz einer modernen „amerikanischen“ Werbung verloren die meisten Investoren Geld. Es ist besonders reizvoll, ein solches Scheitern historisch zu analysieren, denn gängige Lohnschreiber präsentieren vorrangig Erfolgsgeschichten. Das Beispiel Hopkos steht zugleich beispielhaft für die große Zahl von Lebensmittel-„Hypes“, die bis heute immer wieder aufköcheln, von Werbung und (nicht nur käuflichen) Medien unterstützt und forciert. Um 1900 klangen die hoffnungsfrohen Aussagen von Wandel, Reform und Transformation vielfach ähnlich wie heutzutage, die „wir“ immer noch um Antworten angesichts von Alkoholmissbrauch, globaler Ungerechtigkeit und Umweltzerstörung ringen. Wir sind nur neue Hamster im alten Rad.
Dieser Beitrag ist der zweite von insgesamt vier Artikeln, in denen ich der Geschichte des alkoholfreien Bieres empirisch fundiert untersuche. Am Anfang stand eine Arbeit zum „Original alkoholfreien Bier“ des sächsisch-fränkischen Brauers Valentin Lapp (1856-1908). Damit wurde in der Tat Neuland betreten, auch wenn dieses kräftig schäumende und fast alkoholfreie Produkt nur von 1896 bis 1905 verkauft wurde. Der Ihnen vorliegende Artikel wird sich am Beispiel von Hopkos mit den nichtalkoholischen Kunstgetränken beschäftigen, die das Idealbild eines wirklichen Bierersatzes nutzten, um hochverarbeitete Markenartikel anzubieten, die einzig Trugbilder eines solchen Substituts waren. Im dritten Artikel wird es um das alkoholfreie Bier Trinkmit der Bochumer Schlegel-Brauerei gehen, um neuartige Marktchancen, die auch Alkoholproduzenten durch die Verbreiterung des Getränkemarktes erhielten. Viertens schließlich werden diese drei Beispiele in den breiten Kontext der Neugestaltung der deutschen Trinkkultur um die Jahrhundertwende gestellt werden, die ein treffliches Spiegelbild der laufenden Versuche sind, „unsere“ heutige Ernährung fundamental umzugestalten.
Britische Ursprünge – Hopkos und Gingerbeer
Der Begriff „Hopkos“ führt erst einmal ins England der 1890er Jahre. John Abbey, Sekretär der Church of England Temperence Society in Norwich, hatte in den späten 1880er Jahren in zahlreichen Pamphleten mannhaft gegen die Trunksucht der Arbeiter, insbesondere aber der Landarbeiter agitiert. Wohlbegründet verwies er auf den durch Alkohol bewirkten körperlichen und geistigen Verfall, auf die Gefahren für das Familien- und Berufsleben, auf die persönlichen und volkswirtschaftlichen Kosten (John Abbey, Thoughts for Working Men, London 1889). Doch er wusste offenkundig um die begrenzte Wirksamkeit moralischer Appelle. 1891 bot er daher auch praktische Anregungen, präsentierte Rezepte von drei griffig benannten alkoholfreien Sommergetränken: Stokos wurde aus Haferflocken, Zucker und geschnittenen Zitronen zubereitet, Cokos war ein Mischgetränk aus Haferflocken, Kakao und Zucker. Hopkos schließlich bestand aus Hopfen, Ingwer und Zucker, der namensgebende Hopfen konnte auch durch getrockneten Andorn ersetzt werden. Abbey verwies stolz darauf, dass das alkoholfreie Trio “quite popular with the crop-gatherers of 1892” geworden sei (Three Temperance Beverages, Journal of the American Medical Association 23, 1892, 677). Die Anglikaner griffen den Vorschlag auf, popularisierten ihn, Mitglieder berichteten von einer schmackhaften und erfrischenden Alternative zum schweren Porter, zum dunklen Ale: „‚That is good!‘ ‚This is better than ale!’ ‘This is something to work upon!’ ‘I should like a recipe of this!’” (C.E.T.S Work at the Rotts. Agricultural Show, Southwell Diocesan Magazine 6, 1893, 107-108, hier 108). Auch Spottgedichte über die neuen alkoholfreien Billiggetränke wurden geschrieben, auch sie halfen Stokos, Cokos und Hopkos weiter zu popularisieren.
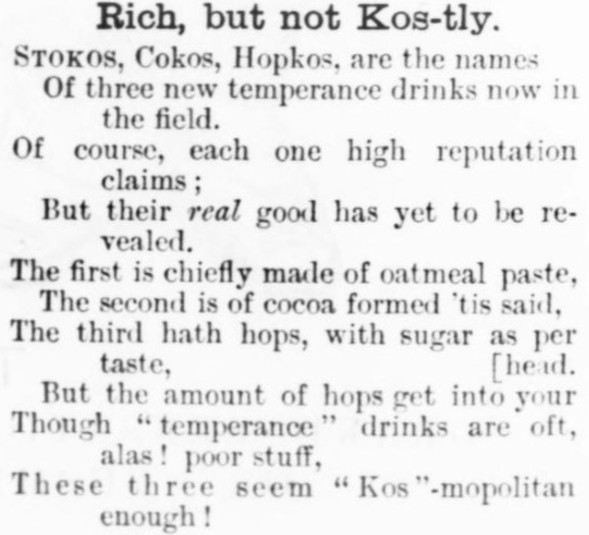
Spottgedicht auf die Mäßigkeitsgetränke – Hopkos war billig und wirksam (Fun 53, 1891, 250)
Die Rezepte verbreiteten sich rasch über England hinaus, fanden sich in den USA, im britischen Empire (Items of Interest 15, 1893, 561; American Analyst 9, 1893, 157; Hawaiian Gazette 1893, Nr. 43 v. 24. Oktober, 4; The Cultivator & Country Gentleman 58, 1893, 661; The War Cry 4, 1898, Nr. 2, 12; Hildagonda J. Duckitt, Hilda’s Diary of a Cape Housekeeper, London 1902, 234 (Südafrika); Pearsons’ Weekly 1904, Nr. 735 v. 18. August, 118; ebd. 1905, Nr. 784 v. 27. Juli, 62; W.H. Simmonds, The Practical Grocer, Bd. 4, London 1909, 190; Everything a Lady should know, 26. Aufl., hg. v. George B. Philip & Son, Sydney s.a. [1923-24], 69 (Australien)). Stokos, Cokos und Hopkos etablierten sich, wurden die Rezepte doch immer wieder in Zeitungen und Zeitschriften reproduziert, fanden ihren Platz in gängigen Kochbüchern. Auch in Europa gab es beträchtlichen Widerhall; die Sommergetränke ließen sich zudem in den „Tropen“, also den europäischen Kolonien, häuslich zubereiten (De Baanbreker 10, 1911, Ausg. v. 12. August, 4).
Die drei Nichtalkoholika fanden auch rasch den Weg nach Österreich-Ungarn und ins Deutsche Reich, wo der Anteil der Landarbeiter deutlich höher lag als im Stammland der Industrialisierung (Englische Sommergetränke, Neueste Erfindungen und Erfahrungen 18, 1891, 514-515; dass., Die Fundgrube 19, 1892, 577). Dort versuche man zeitgleich, den paraguayischen Mate-Tee einzuführen (Maté als Getränk für Landarbeiter, Das Land 3, 1894/95, 313-314). Die neuen englischen Rezepte boten ergänzende Optionen, forderten aber angesichts der noch holz- und kohlenbefeuerten Herde Hausfrauen, Köchinnen und Dienstbotinnen: „Hopkos: 25 g Hopfen und 15 g gepulverter Ingwer werden 25 Minuten hindurch in 6,75 l Wasser gekocht, dann setzt man zur Flüssigkeit 500 g Rohrzucker, kocht weitere 10 Minuten, seiht das Getränke [sic!] durch ein sauberes leinenes Tuch und füllt den Hopkos auf die Flasche“ (Josef Bersch, Chemisch-technisches Lexikon, Wien, Pest und Leipzig 1893/94, 251).
Stokos, Cokos und Hopkos standen Anfang der 1890er Jahre für eine große Zahl in den deutschen Landen bekannten und vornehmlich im Norden auch getrunkenen „englischen“ Getränken, von denen das Ginger Beer, das Ingwerbier, sicherlich das bekannteste war. Ähnlich wie Hopkos wurde es lange häuslich hergestellt. Dazu mischte und verkochte man Ingwer etwa mit Zucker, Limonensaft und Eiweiß, mengte Honig und Zitronenöl hinzu, füllte die Masse dann nach vier Tagen Lagerung ab (Die Reform 1863, Nr. 102 v. 26. August, 2). In Großbritannien, vornehmlich in Nordengland und Schottland gab es schon längst ein breit gefächertes Angebot, mehr als tausend Markennamen zeugten von einem beträchtlichen kommerziellen Erfolg. Die Hausbrauerei wurde parallel von vorgefertigten Extrakten aus Hopfen, Kräutern, zunehmend aber auch Essenzen, ätherischen Ölen, Aromen, Süß- und Farbstoffen, umgestaltet (John Burnett, Liquid Pleasures. A Social History of Drinks in Modern Britain, London und New York 1999, 97). Derartige Bierpulver hatten auch im Zollvereinsgebiet die chemisch-technische Modernisierung der Brauerei begleitet, und angesichts etwa des „Berliner Bierpulvers“ der Firma Grüne & Co. unkten Zeitgenossen schon zur Jahrhundertmitte, mit „der Bierbrauerei scheint’s zu Ende zu gehen“ (Westfälische Zeitung 1859, Nr. 167 v. 17. Juli, 2). Diese Vorhersage war verfrüht, die Bierpulver verschwanden rasch, kamen in den späten 1890er Jahren jedoch neuerlich auf, ermöglichten unmittelbar nach der Jahrhundertwende auch breit beworbene Do-it-yourself-Aktivitäten der vor allem im Spirituosenbereich boomenden Essenzenindustrie.

Ingwerbier als Medizinalgetränk (Central-Volksblatt für den Regierungsbezirk Arnsberg 1891, Nr. 27 v. 4. März, 4)
Schon seit Anfang 1890er Jahre, parallel mit dem englischen Hopkos-Rezept, erweiterte sich auch das Angebot von Ingwerbier. Vor allem die in Kassel ansässige Firma Dr. G. Hilgenberg Nachf., Ende 1878 vom Chemiker Gustav Hilgenberg als Mineralwasserfabrik und Laboratorium gegründet (Deutscher Reichsanzeiger 1879, Nr. 5 v. 7. Januar, 4), praktizierte Konsumgütertransfer. Ingwerbier war damals vornehmlich anonyme Apothekerware. Ingwersirup wurde mit Weinsäure und Zuckercouleur versetzt, das schaumige Getränk erinnerte farblich durchaus an Bier (G. Schneider, Alkoholfreie Getränke, Deutsche Apotheker-Zeitung 18, 1903, 794-796, hier 796). Hilgenbergs Firma wurde 1885 vom Kasseler Apotheker Ludwig Scherff (1836-1899) übernommen, der neben Ginger Beer dann auch weitere „alkoholfreie Biere“ produzierte (Wiesbadener Fachausstellung für das Hotel- und Wirtschaftswesen, Wiesbadener General-Anzeiger 1896, Nr. 184 v. 8. August, 1). 1896/97 präsentierte er im Rahmen zahlreicher Ausstellungen alkoholfreies Bockbier, Ale und vor allem Bassara. Bier wurde nach dem Brauen der Alkohol entzogen und Kohlensäure zugesetzt. Das auch als Exportgetränk gedachte Bassara enthielt aus England importierte Pflanzenauszüge, das Rezept aber wurde geheim gehalten. Das schien ein Erfolgsgarant zu sein: “Es ist kaum zu bezweifeln, dass die Getränke bei dem immer mehr an Terrain gewinnenden Streben nach Heilung auf ‚naturgemässe‘ Art, eine grosse Zukunft haben, und es wäre wohl angebracht, wenn die deutschen Apotheker versuchten, den Debit dieser Getränke ihrem Handverkauf zu sichern“ (Pharmazeutische Zentralhalle für Deutschland 38, 1897, 558).

Zwischen Bier und Brause: Werbung für Ingwerbier und Ingwerbier-Extrakte (Neues Tagblatt und Generalanzeiger für Stuttgart und Württemberg 1897, Nr. 136 v. 15. Juni, 14 (l.); Leipziger Tageblatt 1900, Nr. 273 v. 31. Mai, 4487)
Ingwerbier war aus heutiger und auch aus damaliger Sicht gewiss kein Bier, denn es war nicht gebraut worden, hatte keine Gärung durchlaufen. Es wurde dennoch als „alkoholfreies Bier“ beworben (Geschäftsblatt für den obern Teil des Kantons Bern 1899, Nr. 40 v. 20. Mai, 4). Noch gab es keine verbindlichen Definitionen der neuen Produkte, noch herrschte die Setzungsmacht der Anbieter. Die Brauer protestierten gegen derartige Anmaßungen, seien doch Bier und Wein zwingend alkoholhaltig. Auch Abstinente stimmten dem zu: „Diese Getränke verdanken nur der Rücksicht auf die Trinksitte ihren Ursprung und sind nichts als eine lächerliche Nachahmung des Bieres, ohne irgend einen besonderen Vorzug zu besitzen, der ihre Bierform entschuldigen könnte. Sie zeigen nur, wie schwer es den Menschen wird, sich sogar von der Form des Bieres, von dem braunen, schäumenden Getränk, ganz zu trennen, und müssen von der Abstinenzbewegung rücksichtslos abgelehnt werden“ (Georg Keferstein, Ueber die alkoholfreien Getränke, Der Alkoholismus 3, 1902, 266-290, hier 273). Die federführenden Mäßigen aber sahen in derartigen alkoholfreien Bieren ein wichtiges Brückenangebot, konnte man doch dem Alkohol entsagen, ohne mit seinen Trinkgewohnheiten strikt zu brechen.
Der technische Fortschritt schien zudem immer bessere, auch geschmacklich zusagende Angebote zu ermöglichen. Neben die Ingwerbiere traten Ingwerbierkonzentrate, ermöglichten rasch zuzubereitende, brausende und alkoholfreie Erfrischungen. Neue Bierpulver folgten: „Man schüttet einfach einen Eßlöffel der köstlichen Substanz in ein Glas Wasser, und der besiegte Bacchus […] verhüllt sich klagend das Haupt“ (Das Bierpulver!, Bonner Volkszeitung 1901, Nr. 224 v. 7. Juli, 9). Gewiss, noch war der Geschmack gewöhnungsbedürftig, doch grundsätzlich konnte das Trinken so auch billiger werden. Ernst Kochs Bier-Extrakt versprach alkoholfreies Bier für vier Pfennig pro Liter (Vorwärts 1901, Nr. 135 v. 13. Juni, 8). Die neuen Produktbezeichnungen unterminierten allerdings die bestehende Sprache, unterminierten zugleich die Sprache des Rechts. Ein Speisewirt lockte Kunden mit einem unentgeltlichen alkoholfreien Bier, das er „durch Auflösen von Pillen in Wasser herstellte“. Er wurde daraufhin wegen einer fehlenden Schankkonzession letztinstanzlich zu einer Geldstrafe verurteilt (Schankwirtschaft und Zuckerwasser, Kölnische Zeitung 1903, Nr. 446 v. 25. Mai, 1). Damit fügte man neue Kunstgetränke ungewollt in den Reigen des Bestehenden ein.
Intermezzo: Alkoholfreie Biere vor der Gründung der American German „Hopkos“ Company 1903
Die englischen Getränke waren alkoholfrei und wurden seit 1896 auch vermehrt als „alkoholfreie Biere“ vermarket. Deren Erfindung und Etablierung im Deutschen haben wir bereits am Beispiel des „Original alkoholfreien Bieres“ von Valentin Lapp genauer analysiert. Für unsere Analyse des neuen Hopkos sind vier Aspekte festzuhalten:
Auch wenn der Begriff des „alkoholfreien Bieres“ vereinzelt schon Mitte der 19. Jahrhunderts nachweisbar ist und – zumeist mit Bezug auf England – sich seit den späten 1880er Jahren langsam einbürgerte, handelte es sich erstens doch um ein Lehnwort einer technischen Innovation des Schweizer Önologen Hermann Müller-Thurgau (1850-1927). Er pasteurisierte frisch gepresste Fruchtsäfte bei 60-70 °C, ermöglichte dadurch sterile, nicht weiter vergärende Fruchtsäfte. Sie wurden seit 1896 mit breiter Unterstützung von Alkoholgegnern als „alkoholfreie Weine“ vermarktet. Das war sprachliches Neuland, an sich widersprüchlich, zeigte jedoch die Absicht, den Kampf gegen den alten alkoholischen Wein auch praktisch aufzunehmen. In den Anzeigen wurde daher nie nur das Fehlen des Alkohols vermerkt, sondern immer auch die mit der neuartigen Verarbeitung einhergehenden Vorteile, zumal den aufgrund des gestoppten Abbauprozesses höheren Nährwert.
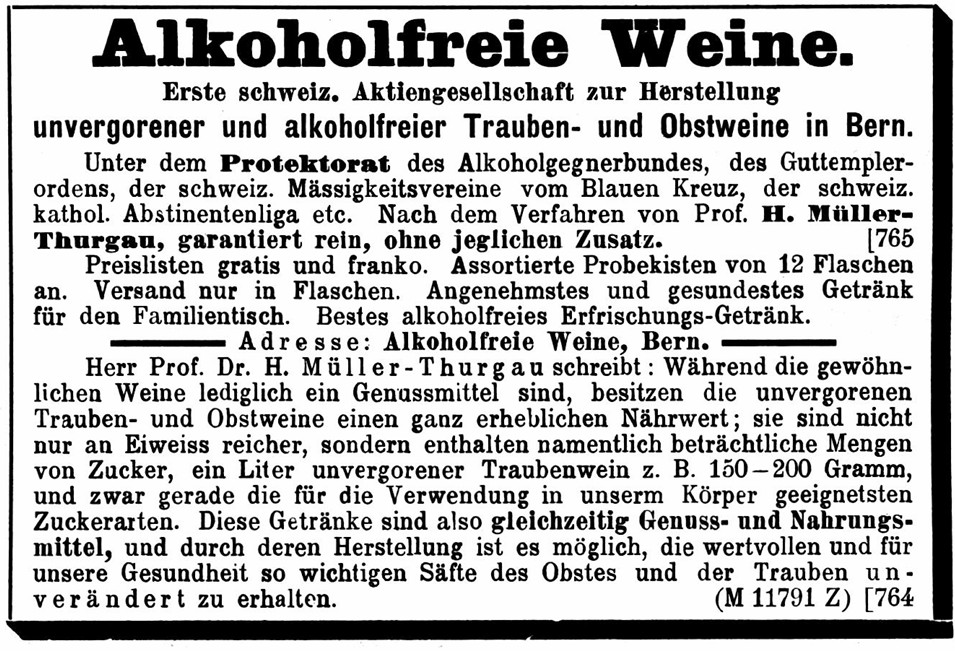
Werbung für Müller-Thurgaus neu entwickelte „alkoholfreien Weine“ (Schweizer Frauen-Zeitung 18, 1896, Nr. 44, Beil., 4)
Müller-Thurgau richtete zweitens das Augenmerk der Ingenieure und Tüftler auf neue Technologien, um auch das Bier alkoholfrei zu machen. Grundsätzlich wurden seit 1895/96 drei Verfahren angewandt: Erstens folgte man dem Schweizer Vorbild, destillierte den Alkohol kunstvoll ab, frischte das Gebräu dann mit Kohlensäure auf. Ein solches Verfahren ließ sich der Chemiker, Lebensreformer, Konserven- und Fruchtsafthersteller Walther Nägeli (1851-1919) 1896 patentieren. Dieser Rechtsakt bedeutete die grundsätzliche Akzeptanz des neuen Begriffs „alkoholfreies“ Bier, gegen den nicht nur die Brauerlobby seit 1898 durchaus erfolgreich Sturm lief. Nägelis Frada-Bier hatte allerdings nur geringen Erfolg, seine Marktpräsenz blieb gering. Zweitens wurde die Bierwürze nicht weiter vergoren, auf eine Gärung also verzichtet. Dem Sud wurde Diastase und auch Hopfen zugefügt, alles zentrifugiert, gefiltert und mehrfach mit Kohlensäure imprägniert. Diesen Weg wählte Valentin Lapp für sein „Original alkoholfreies Bier“, für ein Jahrzehnt der wichtigste Vertreter der neuen Getränkesorte. Beide Verfahren waren aufwändig, erforderten hohe Investitionen. Deshalb begannen drittens insbesondere Apotheker und Mineralwasserfabrikanten an ihre recht simple Technik anzuknüpfen. Ein Mineralwasserapparat erlaubte die Imprägnierung einer Flüssigkeit mit Kohlensäure, zentral für Textur und mundkitzelnde Frische. Anstelle von Wasser konnte man auch Fruchtsäfte sättigen, ebenso Mixturen von Wasser, Malz- und Hopfenextrakten. Das perlende Getränk konnte anschließend mit Süß- und Farbstoffen oder auch Zucker weiter modifiziert werden. Diese dritte Variante hatte den Vorteil geringerer Fixkosten, einfachen Maschineneinsatzes und einer variantenreichen Ausgestaltung des Geschmacks. Der Unterschied zu den damals insbesondere für Kinder und Frauen vermehrt produzierten farbig-grellen und pappig-süßen Brauselimonaden war allerdings gering. Im Gegensatz zu den ersten beiden Verfahren bestand außerdem die Gefahr einer fortgesetzten Gärung. Der kurz nach Hopkos in Hamburg auf den Markt gebrachte Hansatrunk hatte beispielsweise 1,44 Prozent Alkohol (Pharmaceutische Praxis 6, 1907, 152) – und war Teil langwieriger Debatten über Grenzwerte und die Redlichkeit der Hersteller.

Wabernde Begriffe: Alkoholfreier „Hansatrunk“ – mit 1,44 Prozent Alkoholgehalt (Hamburger Fremden-Blatt 1904, Nr. 130 v. 5. Juni, 27)
Drittens waren alkoholfreie Biere nicht nur Reflex auf eine schnelle Mark, auf die Marktchancen der Jahrhundertwende. Sie materialisierten zugleich Forderungen der Mäßigkeitsbewegung nach positiven Hilfsmitteln im Kampf gegen Trunksucht und Alkohol. Alkoholfreies Bier würde die modernde Hast, die modernde Nervosität reduzieren, würde auch die randständige Position der Enthaltsamen verringern. Einmal entwickelt, würde es sich im Lebenskampf durchsetzen: „Wo es Enthaltsame giebt, stellt sich auch bald alkoholfreies Bier und alkoholfreier Wein ein“ (Matthaei, Die Erhöhung der Kriegstüchtigkeit eines Heeres durch Enthaltung vom Alkohol, Der Alkoholismus 1, 1900, 164-184, hier 174). Die großenteils bürgerliche, von protestantischen Pfarrern, Lehrern und Notablen geprägte Bewegung erschien nicht nur als sicherer Nischenmarkt, sondern auch als ein Bundesgenosse für nichtkommerzielle Werbung und Verbreitung. Wirklich „alkoholfreie“ Biere konnten vielleicht auch die schwelenden Konflikte zwischen den bier- und weintrinkenden Mäßigen und den Abstinenten befrieden. Das galt selbst für Nahrungsmittelchemiker. Bernard Carl Niederstadt, Hamburger Chefkontrolleur, empfahl Hopkos nicht nur aufgrund seiner stofflichen Zusammensetzung, sondern auch, „da der Alkohol größere Verheerungen anrichte“ (Hamburger Fremden-Blatt 1903, Nr. 110 v. 12. Mai, 13). Dies wurde von den Produzenten des neuen Bierersatzes unmittelbar verwertet: „Hopkos ist keine schwächliche Limonade, sondern ein bierähnliches, aber alkoholfreies Getränk. Als Kampfmittel gegen den Alkohol unvergleichlich!“ (Hamburger Echo 1903, Nr. 166 v. 19. Juli, 10)
Alkoholfreie Biere etablierten sich seit 1896 im Flaschenbierhandel, langsam auch in den alkoholfreien Cafés und Gaststätten, mochte ihr höherer Preis von den sparsamen Bürgern auch stets moniert werden. Wichtiger bleib viertens aber der ungewohnte Geschmack. Selbst in der Krankenkost urteilten einzelne Ärzte apodiktisch-ablehnend: „Die neuerdings hergestellten ‚alkoholfreien Biere‘ sind wegen ihres schlechten Geschmackes untrinkbar“ (Carl Wegele, Die diätetische Küche für Magen- und Darmkranke, Jena 1900, 18). Süße Bierersatzgetränke mochten davon weniger betroffen sein, doch seitens des Alkoholhandels hieß es immer noch selbstbewusst: „Alle Surrogate und Ersatzmittel für Alkohol erscheinen völlig wirkungslos. Kohlensaure Malzwürze, als alkoholfreies Bier getrunken, ist so wenig Bier, wie eine Brauselimonade ein Champagnerwein sein kann“ (Wattenscheider Zeitung 1904, Nr. 297 v. 28. Dezember, 3). Hopkos wurde folgerichtig als wohlschmeckender alkoholfreier Bierersatz angeboten.
Die American German Hopkos Company und der moderne Touch der Amerikanisierung

Warenzeichen der American German „Hopkos“ Company (Deutscher Reichsanzeiger 1903, Nr. 256 v. 30. Oktober, 12)
Die „American-German Hopkos Company mit beschränkter Haftung“ wurde am 14. Januar 1903 ins Hamburger Handelsregister eingetragen, der Gesellschaftsvertrag war am 3. Januar abgeschlossen worden (Hamburgischer Correspondent 1903, Nr. 25 v. 16. Januar, 5; Hamburger Fremden-Blatt 1903, Nr. 14 v. 17. Januar, 12). Gegenstand des Unternehmens war „die Einrichtung von Fabriken zur Herstellung des alkoholfreien, kohlensäurehaltigen, in Amerika erfundenen und unter dem Namen ‚Hopkos‘ geschützten Getränkes zum Ersatz für helle und dunkle Biere, der Vertrieb dieses Getränkes sowie die Eingehung aller mit diesem Gesellschaftszwecke zusammenhängenden Geschäfte“ (Deutscher Reichsanzeiger 1903, Nr. 14 v. 17. Januar, 13). Das Stammkapital betrug 59.000 M, von den Gesellschaftern wurden nur zwei namentlich erwähnt: Der Magdeburger Unternehmer Theodor Freytag brachte Hopfen und Malzextrakt im Wert von 1250 M ein, die Weißenburger Handelsgesellschaft M. & G. Weid Maschinen im Wert von 1000 M, erhielt aber zugleich eine ungenannte Barauszahlung. Geschäftsführer wurden die beiden Kaufleute Otto Karl Heinrich Schorre und Hermann Friedrich Hannesen. Das oben abgebildete Warenzeichen war bereits am 2. Januar beantragt worden, der vor einer aufgehenden Sonne flügelschlagende Adler hielt die deutsche und die US-amerikanische Fahne in seinen Klauen. Viel Pathos angesichts einer „Limonadenfabrik“, die ein „alkoholfreies, limonadenähnliches Getränk“ produzieren wollte.
Der Firmennamen und das prangende Signet machen stutzig. Schließlich hat uns die Geschichte des Landarbeitergetränks „Hopkos“ nach England geführt, ebenso die Ingwerbiere und Bierextrakte. Doch noch Jahre nach dem Konkurs der Firma hieß es so lapidar wie selbstverständlich: „Hopkos ist ein aus Amerika eingeführtes, alkoholfreies Getränk, das aus Extrakten hergestellt wird“ (Heinrich Timm, Limonaden und alkoholfreie Getränke, Wien, Pest und Leipzig 1909, 165). Trotz emsiger Recherche gibt es jedoch keinen Beleg für diese Kommerzlegende, keine einschlägigen Patente, keine beim späteren Konkurs bevorzugten Zahlungen an Erfinder oder Lieferanten in der neuen Welt. Dennoch machte dieses auch offiziell verbreitete Narrativ wirtschaftlich Sinn. Mit dem globalen Hegemon Großbritannien befanden sich deutsche Kaufleute im Wettbewerb, ebenso die der zweiten Flügelmacht, der aufstrebenden Vereinigten Staaten. Hamburg war zwar Einfuhrplatz englischer Waren, galt als Hort englischer Ideen und Konsummuster. Bei Hopkos aber ging es um den Weltmarkt, um eine gemeinsame Anstrengung der beiden Herausforderer gegen den Hegemon. Amerika war nicht mehr länger das Land der Freiheit und neuer Chancen, in das bis 1914 insgesamt 5,5 Millionen Deutsche auswanderten, um ein besseres Leben zu führen. Es war auch ein Land neuer praktischer Massenprodukte; und diesen Anspruch sollte das neue Hopkos materialisierten. Entsprechend stellte man „American“ vor „German“ – als einzige deutsche Firma vor 1945.

Die amerikanische Invasion im Konsumgütersektor (Der Wahre Jacob 18, 1901, 3553; Hamburgischer Correspondent 1903, Nr. 345 v. 26. Juli, 8)
Die schutzzollbewehrte US-Wirtschaft galt bis in die 1870er Jahren vorrangig als Agrarexporteur, dessen billigen Weizen, Kühl- und Gefrierfleisch, hochwertiges Obst und Gemüse das Deutsche Reich mit Zöllen und Hygienevorschriften begrenzte (vgl. Uwe Spiekermann, Dangerous Meat? German-American quarrels over Pork and Beef, 1870-1900, Bulletin of the German Historical Institute 46, 2010, 93-110). Zunehmend traten aber auch preiswerte massenproduzierte Gebrauchsgüter hervor, etwa Nähmaschinen oder Klaviere. Die Deutschen führten dies lange auf die rührige Exporttätigkeit deutscher Auswanderer und ihrer Söhne zurück – etwa Isaac Merritt Singer (1811-1875) oder Heinrich Engelhard Steinway (1797-1871) –, verstanden aber nicht, dass sich Massenproduktion und hohe Qualität nicht zwingend ausschlossen. Dabei unterstrichen die US-Exporterfolge etwa im Bereich der Elektrotechnik und der Unterhaltungsindustrie, dass die deutsche Wirtschaft dem Hegemon Großbritannien zwar wirtschaftlich zusetzte, dass sie parallel aber unter Druck aus Übersee geriet. Selbst deutsches Bier wurde in den 1890er Jahren von US-Bier in globalen Drittmärkten erfolgreich be- und verdrängt (Stefan Manz und Uwe Spiekermann, Making Food Empires. German Technology and Global Mass Production, 1870-1914, Oxford 2026 (i. E.), Kap. 7 und 8).

US-Einflüsse auf die Trinkgewohnheiten: American Bars und Cocktails (Jugend 8, 1903, 89)
Hopkos, so meine nicht sicher zu belegende These, Hopkos wurde von den deutschen Eignern bewusst (und wahrheitswidrig) als amerikanische Innovation präsentiert, denn so konnten sie auf einer Erfolgswelle schwimmen, die seit der Jahrhundertwende nicht mehr zu ignorieren war: Billige amerikanische Haushalts- und Fitnessgeräte, Uhren und Petroleumlampen, Rechen- und Schreibmaschinen, Schuhe und Fahrräder fanden ihren Weg ins Reich, Kosmetika, Modeschmuck, Korsetts, Füllfederhalter und natürlich Kodak-Fotoapparate wären zu ergänzen. Nicht nur Karl May schuf Bilder des Wilden Westens, sondern auch der exportierte Buffalo Bill oder die gefeierten Schaustellungen von Barnum & Bailey, dem größten Zirkus der Welt. Gleichermaßen verbreiteten sich verarbeitete Nahrungsmittel, Frühstückcerealien wie Quaker Oats, Reformwaren von John Harvey Kellogg oder Maizena Maisprodukte. Die Hafenstadt Hamburg war dabei vielfach der Ausgangspunkt für die Eroberung des deutschen Marktes, etwa beim zeitgleich vermarkteten Nährmittel Force (Hannoverscher Courier 1903, Nr. 24199 v. 27. Januar, 4; Schwäbischer Merkur 1903, Nr. 91 v. 25. Februar, 10). Auch wenn die Deutschen amerikanische Limonaden und Temperenzgetränke kaum schätzten, waren diese in den US-amerikanischen Kolonien in den Großstädten durchaus gängig. Hopkos schloss an all das an, ihre Macher wollten davon profitieren.
Erträge durch angewandte Wissenschaft und Technik. Die „Macher“ von Hopkos
Meine Skepsis gegenüber den amerikanischen Ursprüngen des alkoholfreien Getränkes resultiert auch aus genaueren Informationen über die führenden Repräsentanten der neuen American-German Hopkos Company. Es handelte sich fast durchweg um junge, hochqualifizierte Naturwissenschaftler und Kaufleute, die den Märkten ihrer Zeit mit neuen Konsumgütern, mit massenfabrizierten Markenartikeln, ihren Stempel aufdrücken wollten. Schauen wir uns also die Riege quirlig begabter Herren näher an.
Theodor Freytag war nicht ohne Bedacht der erstgenannte Gesellschafter. In Magdeburg ansässig, war er gewissermaßen der „Erfinder“ von Hopkos, hatte er doch bereits am 20. September 1900 das einschlägige Warenzeichen beantragt, das ihm am 10. November 1900 dann erteilt wurde. Er dürfte zuvor von den drei englischen Temperenzgetränken gehört haben, noch 1905 sicherte er sich das erinnernde Warenzeichen Storkos (Warenzeichenblatt 1906, 49). Das Hopkos-Warenzeichen wurde allerdings erst am 25. Juli 1903 auf die Hamburger Hopkos Company übertragen (Deutscher Reichsanzeiger 1903, Nr. 178 v. 31. Juli, 8). Das deutsche Hopkos hatte mit dem englischen Getränk einzig den Namen gemein.

Das offizielle Hopkos-Warenzeichen (Deutscher Reichsanzeiger 1900, Nr. 291 v. 7. Dezember, 12)
Theodor Freytag war Fabrikant von alkoholfreien Erfrischungsgetränken. Seine Magdeburger „Frucht-Sirup- und Essenzen-Fabrik“ (Deutscher Reichsanzeiger 1909, Nr. 86 v. 13. April, 56), seine „Dampf-Fabrik ätherischer Öle, Essenzen, Fruchtsaftpresserei“ (Adressbuch für Magdeburg 1910, T. I, 73) koppelte die Errungenschaften der modernen Chemie, der weltweit führenden deutschen Aromenindustrie, mit dem Marktbedarf kohlensäurehaltiger alkoholfreier Markenartikel. Während er in Magdeburg nur für einen überschaubaren regionalen Markt produzierte, sollte Hopkos ein Weltgeschäft werden. Dazu aber bedurfte es Partner.

Auszüge aus Theodor Freytags wachsender Palette der immergleichen neuen Produkte (Deutscher Reichsanzeiger 1904, Nr. 43 v. 19. Februar, 13 (o.); ebd., Nr. 219 v. 16. September, 11)
Die Handelsgesellschaft M. & G. Weid lieferte die maschinelle Grundausstattung der Hamburger Firma – und auch der späteren auf Lizenzbasis gegründeten Hopkos-Filialen. Sie war, abseits ihres eigentlichen Handelsgeschäfts, seit 1896 in einem Wachstumsmarkt tätig, produzierte immer wieder verbesserte Mineralwasserapparate zur selbsttätigen Abfüllung in Flaschen (Bonner Volkszeitung 1896, Nr. 28 v. 25. Januar, 3). Schon 1900 offerierten die beiden in Weißenburg im Elsass ansässigen Kaufleute reichsweit eine „Anleitung und Rezepte zur Selterswasser-, Brauselimonade-, Schaumwein- etc. Fabrikation“ (Hamburger Echo 1900, Nr. 64 v. 17. März, 8; Hamburger Neueste Nachrichten 1900, Nr. 65 v. 18. März, 14; Lippische Landes-Zeitung 1900, Nr. 64 v. 16. März, 3; Badische Presse 1900, Nr. 64 v. 17. März, 7). Der Wachstumsmarkt karbonisierter Getränke lockte, unbedingt alkoholfrei mussten diese allerdings nicht sein. Mit „Weids Ideal“ verkauften M. & G. Weid seit 1902 einen neuen Apparat, mit dem Wasser „ohne Fachkenntnisse“ mit Extrakten und Kohlensäure versetzt werden konnte. Seine Tagesproduktion lag bei 500 bis 1000 Flaschen. Eine derart bereitete Flasche Mineralwasser kostete einen Pfennig, Brauselimonaden zwei bis drei Pfennige. Schaumwein resp. Milchsekt dürften etwas teurer gewesen sein (Der Schwarzwald 14, 1902, Nr. 17, 15). Durch diesen Apparat konnte man auch Hopkos preisgünstig herstellen, konnte die damals recht hohen Handelsspannen der preisgebundenen Markenartikel problemlos tragen, zugleich einen hohen Gewinn erzielen. Die Einrichtung und die Vertragsverhandlungen forderten Präsenz in Hamburg, entsprechende Übernachtungen der Weids in Hamburger Hotels sind nachweisbar (Hamburger Fremden-Blatt 1903, Nr. 4 v. 6. Januar, 8; ebd., Nr. 40 v. 17. Februar, 8; ebd., Nr. 82 v. 7. April, 20).

Preiswerte Technik für die neue alkoholfreie Getränkewelt (Der Schwarzwald 14, 1902, Nr. 17, 15)
Über die beiden Geschäftsführer ist weniger bekannt. Otto Karl Heinrich Schorre war Mitinhaber der im Jahr zuvor gegründeten nicht näher spezifizierten offenen Handelsgesellschaft Schorre & Co. (Hamburgischer Correspondent 1902, Nr. 279 v. 18. Juni, 4). Diese kümmerte sich um ein erstes werbeträchtiges Hopkos-Plakat, eventuell auch um weitere Werbeklischees (Deutscher Reichsanzeiger 1903, Nr. 37 v. 12. Februar, 29). Ebenso greifbar war das Interesse an marktgängigen Konsumgütern. Schorre & Co. agierte 1904 als Generalagentur von Kummers Kuchen, einer neuen fertigen Kuchenmasse.

Neue Sensationen: Backmischung für willige Hausfrau (Hamburger Echo 1904, Nr. 118 v. 21. Mai, 12 (l.) Warenzeichenblatt 1904, 828)
Derartige Backmischungen kamen damals neu auf, Kummers Kuchen entstammte der Berliner Fabrik von Heinrich Stern (Berliner Tageblatt 1904, Nr. 617 v. 4. Dezember, 47). Sie etablierten sich rasch, basierten auf billigen und gelingsicher vermischten Zutaten. Da der zweite Geschäftsführer zuvor kaum hervorgetreten war – Hermann Friedrich Hannesen agierte lediglich als Liquidator einer Kaffee-Import-Firma (Hamburger Fremden-Blatt 1902, Nr. 89 v. 17. April, 10) – können wir zum anfangs nicht genannten Eigentümer der Hamburger Hopkos Company übergehen, dem Chemiker Bruno Friling (1870-1934). Sein Name zierte von Januar bis April alle Hamburger Hopkos-Anzeigen (Hamburger Nachrichten 1903, Nr. 47 v. 29. Januar, 8), ehe er sich dann auf das wohl lukrativere Feld der Backmischungen konzentrierte.

Eine sichere Sache: Frilings fertige Kuchenmasse „Backe bequem“ (Hamburger Fremdenblatt 1904, Nr. 148 v. 26. Juni, 23)
Doch der Reihe nach: Peter Julius Bruno Friling wurde im August 1899 mit einer Dissertation „Ueber β-Benzylisochinolin“ promoviert, interessierte sich also für Alkaloide des Schlafmohns – und wohl auch für die damals aus den Naturstoffen gewonnenen opiatbasierten Medikamente, die als Schmerz- und Schlafmittel einige Zeit freudig-unschuldig eingesetzt wurden. Nicht nur Cannabis war damals frei käuflich. 1901 wurde der junge Chemiker Prokurist bei Möller & Linsert, einer Hamburger Fabrik chemischer und pharmazeutischer Präparate, verließ diese aber Ende August 1902 (Hamburger Fremden-Blatt 1902, Nr. 13 v. 16. Januar; Hamburgischer Correspondent 1902, Nr. 411 v. 3. September, 5). Über seine anschließenden geschäftlichen Beziehungen zu Hopkos konnte ich nichts in Erfahrung bringen. Friling, der schon parallel zur Hopkos-Etablierung eine eigene Kommanditgesellschaft gegründet hatte, beantragte Ende Juli 1903 jedenfalls das Warenzeichen seiner neuen Backmischung, das unter dem Markennamen „Backe bequem“ ein kommerzieller Erfolg wurde (Hamburgischer Correspondent 1903, Nr. 49 v. 30. Januar, 6; Deutscher Reichsanzeiger 1903, Nr. 304 v. 29. Dezember, 12). Der Begriff zeugt von einer genauen Kenntnis der damaligen Werbesprache, in der aktivierende Slogans modisch waren: „Werde gesund“ war die Dachmarke einer Berliner Fabrik heilgymnastischer Apparate; und das den Kaiserbart festigend-stützende Bartbindenwasser „Es ist erreicht“ des Hoffriseurs Francois Haby (1861-1938) wurde gar zu einem häufig karikierten Signet der wilhelminischen Gesellschaft (Lustige Blätter 18, 1903, Nr. 19, 13; ebd., Nr. 1, 20). „Backe bequem“ enthielt, wie Hopkos, nur „beste Zutaten“, stand unter chemischer Kontrolle und ermöglichte acht verschiedene Kuchensorten zu relativ billigem Preis. 1906 siedelte die von Friling gegründete Nährmittelfabrik schließlich nach Berlin über (Hamburger Correspondent 1904, Nr. 174 v. 29. Januar, 5; Gordian 12, 1906/07, 697-698).
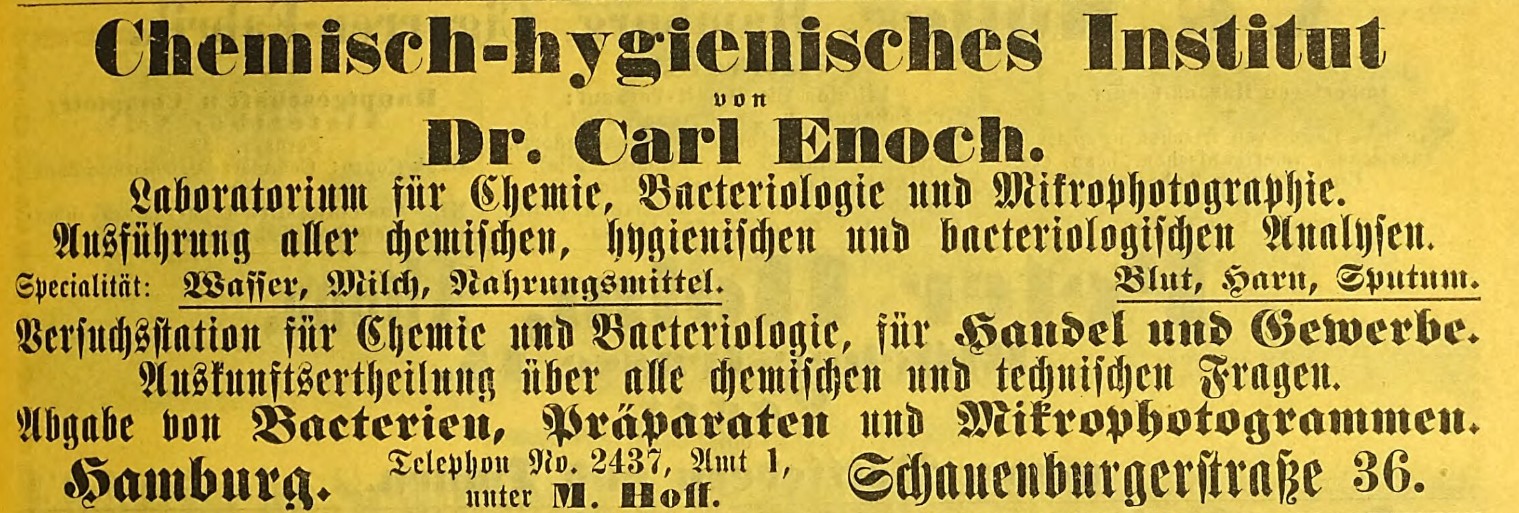
Unternehmen Handelschemie: Vorstellung von Carl Enochs Chemisch-hygienischem Institut (Hamburger Adressbuch 1893, Werbung, 19)
Ein „Macher“ fehlt noch. Carl Enoch (1866-1922) überwachte die Produktion von Hopkos, hatte zudem ein werbeträchtig ausgeschlachtetes Gutachten über dessen chemische Zusammensetzung erstellt. Enoch hatte im Laboratorium von Emil Fischer (1852-1919) in Würzburg gearbeitet, promovierte 1890 unter Leitung von Julius Tafel (1862-1918) in Erlangen über Säureamide. Er wechselte anschließend als Assistent an das Prager Hygienische Institut unter Ferdinand Hueppe (1852-1938), einem führenden Hygieniker, zugleich Eugeniker, Abstinenter, Antisemit und später auch erster Vorsitzender des Deutschen Fußball-Bundes. Der jüdische Chemiker Carl Enoch zog rasch nach Hamburg weiter, wo er 1892 ein Chemisch-hygienisches Institut gründete (F.W. Eitzen, Hamburger Börsenfirmen im Jahre 1898, Hamburg und Berlin s.a. [1898], 116). Mit ambivalenten Marktangeboten kannte er sich bald aus, teilte er doch die Geschäftsadresse mit der Vertriebszentrale des Malzextraktproduzenten M. Hoff, ehe er mit seinem Laboratorium 1900 umzog.
Enoch war ein erfolgreicher Unternehmer, zugleich ein glänzender Wissenschaftler, 1900 zum Ehrenmitglied der Londoner „Society of Biological Chemistry” gewählt (Hamburgischer Correspondent 1900, Nr. 469 v. 6. Oktober, 12). Als einer von knapp zwanzig in Hamburg vereidigten Handelschemikern übernahm er vielfältige Gutachten, bewertete dabei neue Präparate häufig positiv und anbieterfreundlich. Das betraf etwa das zum Brauen geeignete Konservierungsmittel Chinosol, das Haarfärbemittel Gloria-Wasser und das frühe Haarshampoo Javol, nach der Jahrhundertwende das Desinfektionsmittel Vitalin, das pepsinhaltige Magenmittel China-Bitter und die Angebote der Antwerpener General Wine Company. Enoch war ein Mann für das öffentlich vorzeigbare Gutachten, der seinen analytischen Blick kundennah zu begrenzen wusste. Das galt auch für Hopkos. Der weit über Hamburg geschätzte Enoch war zugleich Temperenzler und ein Mann vom Fach. Im Jahre 1900 wurden ihm gleich zwei Patente „zur Herstellung blanker, alkoholfreier Fruchtsäfte“ erteilt (Hamburger Fremden-Blatt 1901, Nr. 286 v. 6. Dezember, 21; ebd. 1902, Nr. 50 v. 28. Februar, 21).
Fasst man diese biographischen Skizzen zusammen, so handelte es sich bei den Machern von Hopkos um wissenschaftlich hochqualifizierte, um zumeist junge aufstiegsorientierte Männer, die ihre Expertise konsumnah nutzten, um gewinnträchtige Markenartikel im Massenmarkt zu etablieren. Obwohl sie sich alle um den neuen Bierersatz Hopkos scharten, besaßen sie sämtlich jedoch genügend Flexibilität und rasch zu erschließende alternative Optionen, um ihr Geschick auch mit anderen ähnlichen Produkten zu versuchen. Die Macher waren an einer schnellen Mark interessiert, nicht an einem spezifischen Produkt, das nur Mittel zum Zweck war.
Zwischen Ingwerbier, alkoholfreiem Bier und Limonade: Was war Hopkos?
Hopkos wurde in Hamburg, aber auch an allen Filialorten als ein neuartiges Getränk fernab gängiger Kategorien angeboten: „Es gleicht den Bieren im Aussehen und Farbe und ist erfrischender, bekömmlicher und äußerst wohlschmeckend“ (Pester Lloyd 1903, Nr. 124 v. 26. Mai, 4). Hopkos war ein karbonisiertes Getränk, ähnlich und doch besser als Bier, farblich erinnerte es an Ingwerbier. Den Anspruch verdeutlichen die unteren Werbezeichnungen. Hopkos wurde in zwei Varianten, als Helles und Dunkles, in kleinen mit aufwändigem Bügelverschluss versehenen Flaschen angeboten. Es stand für die Selbstbehauptung des Menschen angesichts der in der Natur, ja im Menschen selbst stetig stattfindenden Gärung, der scheinbar nicht stillzustellenden Alkoholproduktion. Dies führte zu lebensbedrohlichen Stoffwechselprozessen, zum Abbau, zum frühen, zu frühen Tod. Doch der mannhaft-beherzte Hopkostrinker konnte durch Kauf, konnte durch Konsum diese Gefahr reduzieren, dem Tod ein Schnippchen schlagen.

Den Tod bannen: Werbedarstellung als gesundheitlicher Labetrunk (Frankfurter Zeitung 1903, Nr. 136 v. 17. Mai, 1. Morgenbl., 4; ebd., Nr. 169 v. 20. Juni, 4. Morgenbl., 3 (l. u. r.))
Fernab der Marktsphäre urteilten die Nahrungsmittelchemiker prosaischer, unterminierten den güldenden Glanz des vermeintlich amerikanischen Gesundheitstranks. Der schon erwähnte Bernhard Carl Niederstadt resümierte, dass Hopkos eine Mischung kohlensäurehaltigen und gefärbten Wassers mit Malz- und Hopfenextrakten sei: „Es ist davon ein dunkler Porter und ein heller Ale im Handel. […] In beiden Getränken ist gut Hopfen und Malz enthalten. Fremde Bitterstoffe, ebenso Conservierungsmittel (Salicylsäure und Borsäure) fehlen absolut. Die Biere sind absolut frei von Alkohol, sind gut kohlensäurehaltig und gesund“ (Niederstadt, Die Abstinenz und die alkoholfreien Getränke, Allgemeine Zeitschrift für Bierbrauerei und Malzfabrikation 31, 1903, 343-346, hier 345-346, Bundesarchiv Lichterfelde R 86 Nr. 2032). Derartige Analysen konzentrierten sich auf das Endprodukt, die Zusammensetzung und Güte der Einzelkomponenten konnte so nicht ermittelt werden. Das schien aber kaum erforderlich, denn die Produktion folgte der gängigen Praxis der Apotheken bei ähnlichen Getränken. Bierextrakte bestanden zumeist aus dem aufkommenden kalorienhaltigen Zwischenprodukt Invertzuckersirup, zudem aus Weinsäure für einen erfrischend säuerlichen Geschmack. Die gerade im norddeutschen Braugebiet noch häufig zum Schönen der Biere verwandten Hopfenextrakte simulierten mit ihren Bitter- und Aromastoffen eine gewisse Biernähe. Schließlich fügte man Zuckerkulör oder Farbmalzextrakte hinzu, um die Farbe, aber auch den Malzgehalt einzustellen. Die fertige Mischung gab man in Flaschen, füllte dann maschinell kohlensäurehaltiges Wasser hinzu (Schneider, 1903, 796). Das gut geschüttelte Ergebnis konnte schließlich mit einem schönen Namen, etwa Hopkos, verkauft werden.

Hopkos als alkoholfreies Bier (Langenberger Zeitung 1903, Nr. 206 v. 3. September, 4)
In Hamburg konzentrierte sich das Untersuchungsamt allerdings weniger auf die Produktionstechnik. Hopkos schien kein gesundheitsschädliches Ersatzgetränk zu sein (Übersicht über die Jahresberichte der öffentlichen Anstalten zur technischen Untersuchung von Nahrungs- und Genußmitteln für das Jahr 1903, Berlin 1906, 166). Stattdessen konzentrierten sich die Analysen auf die offenkundige Differenz zwischen den Werbeaussagen und dem Stoffgehalt, um den Hersteller wegen unlauteren Wettbewerbs, wegen Verbrauchertäuschung zu belangen. Doch derartiger Trug war schwer nachzuweisen, auch wenn an Enochs Gutachten kollegialer Anstoß genommen wurde. Erste Beanstandungen sowohl nach dem Nahrungsmittelgesetz als auch dem Gesetz gegen Unlauteren Wettbewerb blieben ohne greifbares Resultat (K. Farnsteiner et al., V. Bericht über die Nahrungsmittelkontrolle in Hamburg in den Jahren 1903 und 1903, Hamburg 1905, 70). Hinweise, dass Hopkos hell und dunkel jeweils 0,05 Prozent Alkohol enthalte, reichten angesichts der undefinierten Begriffe „alkoholfrei“ und „alkoholarm“ nicht einmal für eine öffentliche Meldung (Pharmaceutische Praxis 6, 1907, 152).
Die spätere Umfirmierung der American German Hopkos Company in Internationale Hopkos-Gesellschaft führte jedoch zu neuerlichen Untersuchungen. Wie schon 1903 stieß man sich an der intensiven Reklame, stellte bei einer offenkundig verdorbenen Probe auch einen Alkoholgehalt von 0,97 Prozent fest (Internationale Monatsschrift zur Bekämpfung der Trinksitten 18, 1908, 161). Doch das reichte nicht für den vom Nahrungsmittelgesetz verlangten Nachweis einer täuschenden Absicht. Und eine Rückfrage wegen unlauteren Wettbewerbs wurde von der Staatsanwaltschaft abschlägig behandelt, zumal keinerlei Strafanträge vorlagen (Übersicht über die Jahresberichte der öffentlichen Anstalten zur technischen Untersuchung von Nahrungs- und Genußmitteln für das Jahr 1904, Berlin 1908, 146). Angesichts der parallel bestehenden und öffentlich immer wieder beredt beklagten Missstände bei „Geheimmitteln“ oder „Kräftigungsmitteln“ wurden zwar stetig präzisere und schärfere Gesetze gefordert, doch einzig die Novelle des Gesetzes gegen Unlauteren Wettbewerb 1909 sollte mit dem schwammigen Straftatbestand „Verstoß gegen die guten Sitten“ Wildwüchse in der Warenanpreisung etwas stutzen.
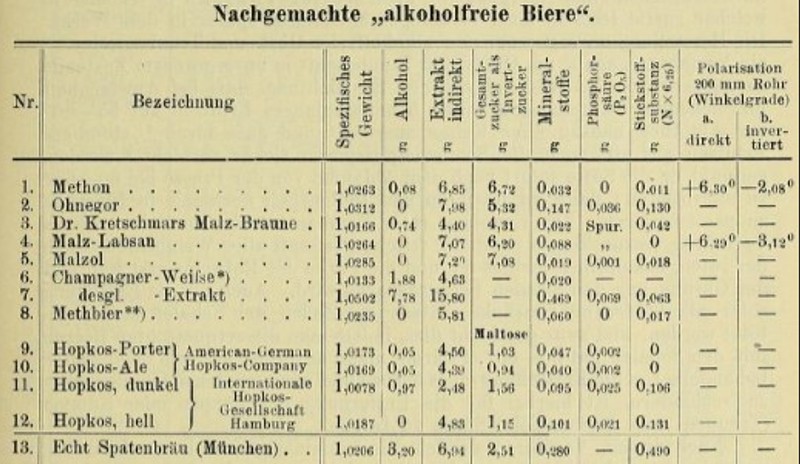
Werbeversprechen und die nachweisbare Zusammensetzung ausgesuchter „alkoholfreier Biere“ (A[dolf] Beythien, Über alkoholfreie Getränke, Sitzungsberichte und Abhandlungen der Naturwissenschaftlichen Gesellschaft ISIS 1905, Dresden 1906, 70-90, hier 79)
So blieb es bei analytischen Daten in der Fachliteratur und benennenden Einschätzungen für Chemiker und Pharmazeuten: „Hopkos, ein alkoholfreier Bierersatz ist […] eine alkoholfreie, mit Kohlensäure imprägnierte Zuckerlösung, welche nur ganz geringe Mengen aus Malz und Hopfen herstammender Bestandteile enthält“ (Neueste Erfindungen und Erfahrungen 35, 1908, 285). Die Brauer fühlten sich in ihrer strikten Ablehnung, in ihren frühen Warnungen bestätigt (Denkschrift des Zentralverbandes der österr. Brauerei-Industriellen-Vereine gegen die projektierte Biersteuererhöhung, Der Böhmische Bierbrauer 36, 1909, 334-338, hier 337). Und die Hamburger Untersuchungsbehörde beanstandete Hopkos pflichtgemäß und folgenlos auch noch 1905, als der Markt, die Verbraucher, schon längst ihr Verdikt ausgesprochen hatten (Fünfter Bericht über die Nahrungsmittel-Kontrolle in Hamburg. II. (Schluß.), Hamburger Fremden-Blatt 1906, Nr. 24 v. 30. Januar, 21). Alle beteiligten Interessenvertreter verteidigten ihre Sichtweisen, hofften auf neue oder altbewährte Konsummuster, auf einen Wandel der Begriffsbestimmungen, der angesichts der Novelle des Branntweinsteuergesetzes (und des Weingesetzes) 1907 auch kam. Es war der Steuerstaat, der Geldbedarf für die Flottenrüstung, durch den der Kranz von Normalbestimmungen auch auf alkoholfreie Getränke ausgeweitet wurde, indem man einfachen und recht willkürlichen Vorgaben der Nahrungsmittelchemiker folgte. Rückblickend führte man sich dann die wilden Zeiten fast schelmisch vor Augen: „Es ist vielleicht auf keinem Fabrikationsgebiet so viel gesündigt worden“ (Walther Schrauth, Genussmittel, ihre Surrogate und ihre Entgiftung, Technische Rundschau 14, 1908, Nr. 35, 501-503, hier 501). Die Macher von Hopkos konnten also ungefährdet und ungestraft am Rande des Rechtes agieren.
Der Geschäftsbetrieb in Hamburg
Die American German Hopkos Company residierte anfangs in einem repräsentativen Kontorhaus, dem Asia-Haus, erbaut vom Schiffsmakler Emil Theodor Lind in Hamburgs Altstadt, am Standort Alte Gröningerstraße 24-25 und Zippelhaus 10, gegenüber der Speicherstadt. Viele Firmen teilten sich die Adresse des mit kolonialen Ornamenten gezierten, vielfach im neuen Jugendstil gehaltenen Geschäftshauses, darunter das technische Büro der Hapag. Der Bau bot große, flexibel eingeteilte Kontore, zudem auch Kellerräume, Personen- und Warenaufzüge und Elektrizitätsversorgung (Hamburgischer Correspondent 1900, Nr. 398 v. 26. August, 15). Das Asia-Haus stand für das Weltgeschäft Hamburgs, bildete zugleich einen Informationscluster: Die dort ab 1904 ansässige Firma Handels- und Schiffsbedarfsfirma Carl Bödiker vertrieb ebenfalls alkoholfreies und auch alkoholhaltiges Bier (Warenzeichenblatt 1907, 48).

Kontorhaus Asia-Haus, Geschäftssitz der American German Hopkos-Company 1903 (Wikipedia-Dirtsc, 2011)
Die repräsentative Hülle des zerstörten, neu aufgebauten und mehrfach aufgehübschten Asia-Hauses darf jedoch nicht vergessen machen, dass die Rekonstruktion des eigentlichen Geschäftsbetriebes nur ansatzweise möglich ist. Die Hopkos-Company und ihre Macher haben keine Archivalien hinterlassen. Werbeanzeigen in einem für Übertreibungen und auch bewusste Irreführungen bekanntem Marktsegment haben nur begrenzten Aussagewert, gewerbliche An- und Abmeldungen, Warenzeichen und Patente bieten allein ein karges Informationsraster. In einem sich weitenden Marktfeld beurteilten Zeitgenossen häufig nicht die einzelnen Produkte, sondern eher die gesamte Branche. Oder erinnern Sie sich an einzelne vegane Markenartikel? Auch Hopkos war Flugsand der Geschichte.
Die Markteinführung des namensgebenden Getränks begann zwei Wochen nach der Konstituierung des Unternehmens. In den Hamburger Zeitungen tönte es weltenwendend: „Der American-German Hopkos-Company Zentrale Hamburg, ist es gelungen, ein alkoholfreies Getränk ‚Hopkos‘ herzustellen, welches in jeder Beziehung den Anforderungen an ein gesundes, wohlschmeckendes und durststillendes Getränk entspricht. Nicht nur allen Gesunden, Kranken und Rekonvalescenten ist es als ein vornehmes Tafelgetränk zu empfehlen, sondern es ist auch ein äußerst nahrhaftes und bekömmliches Volksgetränk. Es wirkt erfrischend und anregend. Da das Bier auch durchaus nicht teurer ist wie unsere billigsten Biere, darf mit der Erfindung des Hopkos ‚Ale‘ und Hopkos ‚Porter‘ die so wichtige soziale Alkoholfrage um ein gut Teil gelöster erscheinen“ (Hamburger Fremden-Blatt 1903, Nr. 27 v. 1. Februar, 20). Das moderne Leben mit seiner Hast, seinem „vielfach rasenden Tempo“ verbrauche rasch die Kräfte, verbiete aber zugleich den Alkoholkonsum, den „so zu Herzen gehenden Trank des Gambrinus“. Hopkos erlaube Erholung und Gemütlichkeit ohne Harm, zugleich fördere es die Verdauung, verdränge die Harnsäure, fördere „das Wohlbefinden des Menschen“ (Zeitgemäße Betrachtungen, Hamburger Nachrichten 1903, Nr. 53 v. 1. Februar, 3). Hopkos bekämpfe auch die bei rastlos tätigen Menschen immer wieder eintretende Erschöpfung, die bei alkoholischen Erfrischungen wie dem Bier nicht zu vermeiden sei. „Analysen erster Autoritäten der Nahrungsmittel-Branche“ würden bestätigen, dass dieses „aus reinsten Ingredienzien“ bestehende Getränk Neuland beträte (Hamburgischer Correspondent 1903, Nr. 53 v. 1. Februar, 18). Nicht Limonade oder Selterswasser, schon gar nicht Bier, sondern Hopkos materialisiere die Zukunft des Trinkens des modernen, tätigen und vorwärtsstrebenden Menschen (Ein neues Volksgetränk, Hamburger Neueste Nachrichten 1903, Nr. 28 v. 3. Februar, 5).
Hopkos wurde als neues, gesellschaftliche Probleme aufgreifendes und ansatzweise lösendes alkoholfreies Getränk präsentiert, als Substitut gleichermaßen für Bier und die alten schwachen karbonisierten Wässerchen. Hopkos wurde als Getränk für alle angeboten, mochte der Schwerpunkt des Lobpreises auch auf den modernen Bürger, den modernen Angestellten zielen. Hopkos war ein Labetrunk für Alt und Jung, für Männer und Frauen, für Gesunde und Kranke. Sein Platz war das Kontor, die Arbeitsstätte, das gemütliche Heim, die Krankenstätte, das Sanatorium. Hopkos transformierte den Getränkekonsum – so die Werbung – in eine neue Sphäre, würde die Konkurrenz daher verdrängen, galt doch auch im Markt das Gesetz des Besseren, des Stärkeren. Wir werden dies unten genauer analysieren, denn Hopkos wurde nicht mit nur mit einem schönen Werbebild präsentiert, sondern mit breit angelegten, vielfach variierten Werbemitteln.

Umzug zu einem neuen Fabrikationsgebäude und Prämienangebote zwecks Auslastung der neuen Produktionskapazitäten (Hamburgischer Correspondent 1903, Nr. 229 v. 17. Mai, 26 (l.); Hamburger Neueste Nachrichten 1903, Nr. 137 v. 14. Juni, 7)
Die Gesellschaft zog Mitte 1903 von der Altstadt in die Arndtstraße 14 im nördlich gelegenen Stadtteil Uhlenhorst um, das nicht lange zuvor erstellte Funktionsgebäude war per Fleet mit der Außenalster verbunden. Das heute denkmalgeschützte Ensemble wurde damals vornehmlich gewerblich genutzt, das Unternehmen annoncierte eine eigene „Hopfen- u. Malz-Extract-Fabrik“ (Hamburger Adressbuch 118, 1904, T. III, 13). Nicht das wahrscheinliche Aussteigen des Eigentümers Bruno Friling stand im Vordergrund, nicht die folgende Staffelstabübergabe des Alltagsgeschäftes an den Generalagenten Carl W. Meyer, der in der Brennerstraße 74-78 residierte, nahe dem Steindamm, einer quirligen Geschäftsstraße im zentralen Stadtteil St. Georg. Auch Meyers parallele Tätigkeit für Alkoholproduzenten, wie die Berliner Bockbrauerei AG, blieb unerwähnt (Verzeichnis der Teilnehmer an den Fernsprechnetzen im Oberpostdirektionsbezirk Hamburg 1903, 42).
Stattdessen präsentierte die American German Hopkos Company den Umzug als Teil einer stellaren Erfolgsgeschichte des neuen Bierersatzes. Dessen „schon jetzt“ enormer Absatz habe „die Uebersiedelung in ein grösseres Fabrikgebäude und die Fabrikation des Extraktes an Ort und Stelle nötig gemacht“. Die dampfbetriebene und mit neuen Maschinen ausgestattete Fabrik habe eine „tägliche Herstellungskapazität von Extrakten zu einem für 250.000 Flaschen reichenden Quantum“ (Hamburger Fremden-Blatt 1903, Nr. 115 v. 17. Mai, 16). Anders ausgedrückt: An der neuen Produktionsstätte wurden Extrakte gefertigt, sie war Zentrum des Versands lizensierter Grundstoffe an die parallel langsam entstehenden Filialen im In- und Ausland. Der Getränkeabsatz dürfte zu dieser Zeit allerdings nicht den erhofften Umfang erreicht haben. Einerseits fabulierte man plötzlich von der neuen Entdeckung einer eminent durststillenden Wirkung des Hopkos, um rechtszeitig zum Sommergeschäft auch Touristen, Radfahrer, Turner und körperlich Arbeitende explizit anzusprechen. Anderseits lobte man kurz nach dem Bezug der neuen Produktionsstätte Erfolgsprämien für Einzelhändler aus, um dadurch den Absatz zu steigern. Für Juli schrieb man einen Wettbewerb aus, in dem der Krämer, der zuerst 1000 Flaschen eingekauft habe, eine Prämie von 50 Mark erhielt. Zugleich zahlte man jedem Abnehmer, der diese Marke überschritt, 10 Mark (Hamburger Fremden-Blatt 1903, Nr. 137 v. 14. Juni, 40). Die Firma gewährte also ohne Reduktion des Endpreises von zehn Pfennig einen Mindestrabatt von zehn Prozent (Hamburger Nachrichten 1903, Nr. 273 v. 14. Juni, 13; ebd., Nr. 285 v. 21. Juni, 4). Bei einer monatlichen Produktionskapazität von nominell 7,75 Millionen Flaschenportionen waren derartige Prämien für recht geringe Abnahmemengen einzig Beleg für einen recht überschaubaren Absatz in Hamburg.
Wir Konsumenten dürfen allerdings nicht ignorieren, dass das Kerngeschäft nicht allein der lokale Absatz eines alkoholfreien Bierersatzes war. Laut Telefonbuch war das Unternehmensziel „Paten[t]verwert.“, ebenso konnte man im Adressbuch lesen: „American-German Hopkos Company mit beschränkter Haftung, Patentverwerthungen“ (Verzeichnis der Teilnehmer an den Fernsprechnetzen im Oberpostdirektionsbezirk Hamburg 1903, 19; Hamburger Adressbuch 117, 1903, Mai-Anhang, 103). Das Hamburger Geschäft hatte Modellcharakter, sollte möglichen Investoren nicht nur abstrakt von Marktchancen tönen, sondern ein belegbares und besichtigungsfähiges Beispiel eines Erfolgsunternehmens geben. Das Hamburger Unternehmen war ein Franchiseunternehmen, gehörte zu den Pionieren dieses heutzutage allgegenwärtigen Geschäftsmodells im Deutschen Reich. Hopkos wurde in Hamburg als Marke etabliert, einheitliche Werbeklischees entwickelt, klare Rezepturen, Maschinen und die geschmacksgebenden Extrakte. Interessierte konnten gegen regelmäßige Gebühren die Rechte für einen entsprechenden Be- und Vertrieb an einem anderen Ort, in einer anderen Region erwerben – und dann in begrenzter Eigenregie Hopkos verkaufen. Der Lizenznehmer trug eigenes unternehmerisches Risiko, nicht jedoch die Kosten für die erfolgreiche Etablierung eines Geschäfts. Der Lizenzgeber profitierte von steten Gebühren, war zugleich gegenüber lokalen Absatzschwankungen abgesichert. Im Deutschen Reich waren damals Gebietsmonopole durchaus üblich, doch diese bezogen sich zumeist auf den alleinigen Absatz eines bestimmten Markenartikels in einem klar umrissenen Gebiet. Steinway-Flügel oder Singer-Nähmaschinen konnte man vor Ort nur von einem Unternehmen kaufen, mochte dieses in Großstädten auch verschiedene Filialen eröffnet haben. Bei Hopkos aber übernahm der Lizenznehmer nicht Fertigprodukte, sondern hatte diese Produkte dezentral selbst herzustellen, erhielt dafür Extrakte und Werbemittel. Das war in den USA durchaus üblich, Coca-Cola ein gutes Beispiel. Im Deutschen Reich gewann das Franchise-System später nicht nur im Getränkesektor an Bedeutung, wo die aus Milchsäure hergestellte Limonade Chabeso seit 1911 diese Geschäftsmodell nutzte (Ueber Milchsäuregetränke und deren Nutzen für die menschliche Gesundheit, Deutsch-Englischer- Reise-Courier 9, 1912/13, H. 11, 11-13).

Auf der Suche nach Investoren „in jeder Stadt der Welt“ (Badische Presse 1903, Nr. 49 v. 27. Februar, 4 (l.); Frankfurter Zeitung 1903, Nr. 57 v. 26. Februar, 3. Morgenbl., 4)
Entsprechend schaltete die Hopkos-Company seit Ende Februar erst reichsweit, seit Mai auch europaweit nahezu gleichlautende Anzeigen in führenden Wirtschaftsmedien, um potenzielle Franchisenehmer mit den neuen Geschäftschancen vertraut zu machen. Hopkos war dabei nur Mittel zum Zweck für eine schnelle Mark, für scheinbar sichere Einkommen. Der Tenor war entsprechend lockend: „Bedeutender Gewinn! Vornehmen, lukrativen Industriezweig bilden die Hopkos-Fabriken in jeder Stadt der Welt. Einheitliche Organisation!! Einheitliche Reklame!! Hopkos […] ist ein Massenconsumgetränk vorzüglichster Qualität. Verkaufspreis per Flasche franco Haus 10 Pfg. für Arm und Reich“ (Schwäbischer Merkur 1903, Nr. 91 v. 25. Februar, 10). Nicht die Reform der Gesellschaft, nicht die Transformation der Trinksitten, nein, die Rendite war treibende Kraft aller Anstrengungen. Die Hopkos-Company lieferte bei Vertragsabschluss „complette Fabrik-Anlagen mit elektrischem Betriebe sammt sämmtlichen zu einem Bierversandt-Geschäft nötigen Requisiten wie: Wagen, Flaschen etc. franco Haus“ (Neues Tagblatt und General-Anzeiger für Stuttgart und Württemberg 1903, Nr. 48 v. 27. Februar, 7). Dieser Service hatte seinen nach Ortsgrößen gestaffelten Preis: In Städten unter 50.000 Einwohner 9000, in Großstädten 25.000 Mark. Hamburg war Vorzeigeort, doch die Gesellschaft verwies auch auf Berlin und Leipzig, auch wenn dort noch keine festen Filialen bestanden. Investoren erhielten zudem Rentabilitäts-Nachweise, also Werbeunterlagen mit ansprechend hochgerechneten lokalen Markterwartungen.
Diese erste Anzeigenwelle führte zum Aufbau von Franchiseunternehmen in Bremen, Berlin, Frankfurt a.M., Leipzig, Wiesbaden – und Ennigerloh. Im Mai begann dann der Einstieg in das europäische Lizenzgeschäft, in das Weltgeschäft. Das „bekannte alkoholfreie Erfrischungsgetränk ‚Hopkos‘“, so hieß es „wird sich bald über ganz Europa verbreitet haben. Die Verbreitung geht mit erstaunlicher Geschwindigkeit vor sich, ein Zeichen, daß dieses als Bierersatz vielgepriesene Getränk eine Lücke füllt.“ Man sprach von einer Hopkos-Vertriebs-Gesellschaft in London, einer russischen Zentrale in Lodsch, von bald folgenden russisch-finnischen, französischen, italienischen, belgischen und holländischen Pendants. Die im Deutschen Reich derweil gegründeten Filialen mutierten zu Zeugen des weitergehenden Aufschwungs, „so daß jeder Deutsche bald überall sein Hopkos trinken kann“ (Hamburgischer Correspondent 1903, Nr. 229 v. 17. Mai, 17; Neue Hamburger Zeitung 1903, Nr. 232 v. 19. Mai, 10). Das war begleitet von neuen, allerdings kürzer gehaltenen Annoncen, die mit der wichtigsten Botschaft endeten: „Großartige Rentabilität!“ (Kölnische Zeitung 1903, Nr. 776 v. 25. August, 4; ebd., Nr. 790 v. 29. August, 4). Andernorts nannte man auch Zahlen. Über eine anvisierte Filialfabrik in Oldenburg hieß es: „Das Kapital verzinst sich mit ca. 300% pro anno“ (Nachrichten für Stadt und Land 1903, Nr. 164 v. 16. Juli, 4). Das war offenkundig illusionär, größerer Trug als der Verkauf eines karbonisierten Getränks als „Bierersatz“, als verbessertem alkoholfreiem Bier. Doch die Zahlen blendeten nur wenige. Im September versprach die American German Hopkos-Company nicht mehr länger „Große Rentabilität“, sondern hatte bereits Mittelsmänner einschaltet, das kriselnde Geschäft teils übergeben (General-Anzeiger der Stadt Mannheim und Umgebung 1903, Nr. 412 v. 6. September, 6). In der zweiten Jahreshälfte zeigte sich erst in Deutschen Reich, in der Folge auch im europäischen Ausland, dass die Verheißungen trogen, dass Hopkos ein Auslaufprodukt war. Das alkoholfreie Getränk teilte dieses Verdikt mit vielen anderen ähnlichen Produkten, auch wenn die Macher von deren Scheitern durchaus lernten.
Ein Blick auf die Konkurrenz: Methon als Beispiel
Die American German „Hopkos“ Company war als nationales, gar multinationales Franchiseunternehmen, mochte ihr auch kein durchschlagender Erfolg beschieden gewesen sein. Das alkoholfreie Getränk sollte Bier ersetzen, stand zugleich aber in erbittertem Wettbewerb mit anderen alkoholfreien Angeboten. Deren Macher annoncierten abschätzig: „Alkoholfr. Bier (Methon), sehr wohlschmeckend, nicht zu verwechseln mit Hopkos!“ (Velberter Zeitung 1903, Nr. 217 v. 16. September, 4). Hopkos präsentierte sich als Bierersatz, vereinzelt auch als alkoholfreies Bier. Dieser Anspruch war unbegründet, die Analysen hatten dies offenbar unterstrichen. Und doch stand Hopkos für zahlreiche Versuche, Bier nicht technisch, sondern chemisch nachzubilden. Uns Nachgeborenen mag dies anmaßend erscheinen, doch nicht so unseren Ahnen: Kindermehle und Säuglingsmilch bildeten seit den 1860er Jahren die Muttermilch chemisch nach, um Gewinne zu erzielen und die horrende Säuglingssterblichkeit zu verringern. Aus Sicht der Tüftler bildeten sie Stoffkonglomerate, die um Kohlehydrate resp. Eiweiß gruppiert waren, sich aber dem Ideal der Muttermilch annäherten. Das naturwissenschaftlich-chemische Denken kreiste um Gemeinsamkeiten fernab des Alltagswissens, darin waren Rohr- und Rübenzucker gleichermaßen Glukose. Alkoholfreies Bier war demnach ein Getränk, das der chemischen Zusammensetzung des Bieres möglichst nahe kam. Geschmack, Textur, Technologie und Tradition erschienen demgegenüber zweitrangig. Wer fragte schon ein Baby (einen Kunden) nach seinen Präferenzen, entscheidend war der Nährerfolg (Markterfolg).
Das oben beworbene Methon war eines der neuen alkoholfreien Getränke, dessen Absatz durch Hopkos grundsätzlich bedroht wurde. Das Warenzeichen war sieben Monate vor Hopkos im Mai 1900 für die Dresdener „Fabrik ätherischer Oele und Essenzen“ von Franz Hermann Loebel in Dresden. Sie hatte sich bis Mitte der 1890er Jahre vor allem auf Zwischenprodukte konzentriert, belieferte Bäcker, Konditoren, Destillateure, Süßwaren- und Getränkehersteller (Kölnische Zeitung 1895, Nr. 207 v. 9. März, 11). Doch in den Folgejahren öffnete sich Loebel auch dem Endkundengeschäft. Vor Methon offerierte er schon den Bierextrakt Süss-Meth-Extrakt (Deutscher Reichsanzeiger 1900, Nr. 259 v. 30. Oktober, 13), 1903 folgte die Limonade Apfelborn und die Brotaufstriche Schleckerchen und Frugalin. Begleitet war all das von verbalem Klappern; ein Flugblatt über Süss-Meth tönte hoffnungsfroh, das die Herstellung alkoholfreien Bieres nun „bequem und einfach ohne irgend welche Neuanschaffungen mit denjenigen Apparaten und Einrichtungen vorgenommen werden kann, welche in jeder, auch der kleinsten Mineralwasserfabrik vorhanden sind. Das neue Volksgenußmittel, das technisch, da seine Herstellung nicht auf dem altüblichen Maisch-, Brau- und Gährverfahren beruht, nicht als ‚Bier‘ zu bezeichnen ist, gelangt unter meiner Originaletiquette Süßmeth-Extract zur Einführung.“ Das war alkoholfreies Bier in chemischer Nachbildung. Brauer urteilten abschätzig: „Wir glauben kaum, daß sich auch nur ein vernünftiger Mensch auf der Welt finden dürfte, der Lust hat, diesen sonderbaren Extract zu versuchen“ (Zitate n. Unfug mit der Wortbezeichnung ‚Bier‘, Gambrinus 27, 1900, 248-249).

Methon, suggestiv angezeigt als „Alkoholfreies Bier“ (Deutscher Reichsanzeiger 1901, Nr. 83 v. 9. April, 15)
Ähnlich, doch aktiver wurde das Folgeprodukt Methon beworben: „Alkoholfreie Biere herzustellen war daher längst eine brennende Frage, bisher allerdings ungelöst im Sinne einer Bereinigung von Wohlfeilheit und Schmackhaftigkeit. Neueste Erfahrungen haben in dem würzigen, gänzlich alkoholfreien, patentamtlich geschützten Methon ein Volksgenußmittel gezeitigt, welches mit erfrischendem Geschmack, glanzheller Färbung und prickelndem, sahnigen Mouffleur den hohen Extraktgehalt und die Vollmundigkeit der besten Münchner Biere vereinigt, ohne deren durch den Alkohol bedingte Schwere und berauschende Wirkung zu besitzen. – Nicht nach dem altüblichen Brauverfahren gewonnen, daher frei von allen Gährungskeimen, aber auch frei von künstlichen Süß-. Farb- und Konservierungsmittel ist Methon ein echter Haus-, Familien-, Tafel- und Gesundheitstrank“ (Lippstädter Zeitung 1901, Nr. 41 v. 6. April, 1). Methon war demnach kein Ersatz, sondern eine alkoholfreie Fortentwicklung des Bieres. Auch weißer Rübenzucker wurde als reiner Fortschritt gegenüber dem braunen Rohrzucker voller Rückstände beworben.
Loebel produzierte Methon seit 1900, doch erst nach der Gründung der Deutschen Methon-Gesellschaft im Mai 1901 nahm der Vertrieb Geschwindigkeit auf (Bautzener Nachrichten 1901, Nr. 115 v. 20. Mai, 133). Doch die Methon-Gesellschaft produzierte keine Getränke, sondern lediglich Grundstoffe. Methon wurde unmittelbar am Verkaufsort „frisch“ hergestellt (Lippstädter Zeitung 1901, Nr. 86 v. 20. Juli, 1). Abnehmer erhielten für fünf Mark eine Kiste mit zwei Flaschen fertigem ‚Methon‘ zum Kosten, Extrakt für die Herstellung von 250 Flaschen, Etiketten und eine Erläuterung des Verfahrens (Alkoholfreies Bier, Gambrinus 28, 1901, 291-292). Glasflaschen und ein Mineralwasserapparat wurden vor Ort angekauft. Die Werbung verwies auf den biergleichen Geschmack, die Reinheit des Getränks. Für die Brauer war Methon jedoch irreführender „Pantsch“, handelte es sich doch um nichts anderes als „eine gewöhnliche Brauselimonade ohne Hopfen und Malz“ (Unfug mit der Wortbezeichnung „Bier“, Gambrinus 28, 1901, 673). Eine Analyse des Stettiner Chemikers Paul Mecke konnte im Methon dann auch weder Hopfen noch Malz nachweisen, befand es als eine „parfümirte, mit Schaumessenz versetzte Zuckercouleur“ (Pharmaceutische Presse 6, 1901, 278). Das aus Invertzucker, Saponin und dem bis heute weit verbreiteten E 150 bestehende Getränk geriet darauf unter öffentlichen Druck, musste seine Werbung moderat verändern, wurde aber weiterhin als „alkoholfreies Bier“ angeboten (Gladbecker Zeitung 1901, Nr. 212 v. 14. September, 4: Essener Volks-Zeitung 1902, Nr. 170 v. 26. Juli, 10). Die Deutsche Methon-Gesellschaft stellte ihr Produkt „den besten Bieren gleich“ (Geseker Zeitung 1903, Nr. 54 v. 7. Juli, 4). Als vermeintlichen Beleg nutzte sie dafür ein Gutachten des Dresdner Nahrungsmittelchemikers und Inhaber eines öffentlichen chemischen Laboratoriums Friedrich Schmidt.

Trotzwerbung gegen die chemischen Untersuchungsergebnisse (Dresdner Neueste Nachrichten 1906, Nr. 219 v. 15. August, 14 (l.); ebd. 1909, Nr. 225 v. 20. August, 13)
Das Konkurrenzprodukt Methon dürfte von den Machern des Hopkos präzise analysiert worden sein. Es war demnach erstens ratsam, polarisierende Begriffe wie „alkoholfreies Bier“ nicht zu verwenden, diese zu umschreiben, die Assoziationsfähigkeit der (deutschen) Sprache zu nutzen. Es war zweitens ratsam, die Überzeugungskraft der Wissenschaft von Beginn an zu nutzen, mit einem eigenen Gutachten voranzugehen, nicht auf spätere chemische Kontrollen zu warten. Drittens schien es ratsam, den bei Methon grundsätzlich noch vorhandenen Zugriff auf die wertgebenden Grundstoffe nicht aus der Hand zu geben. Die Analyse allein des Endproduktes bot viel mehr Ausflüchte – und entsprechend weniger Möglichkeiten der Regulierung oder gar sanitätspolizeilicher Intervention. Methon mochte ein irreführend beworbener Bierersatz und Konkurrent von Hopkos gewesen sein. Doch zugleich war es ein Steigbügelhalter für eine passgenauere, mit dem geltenden Recht nicht im direkten Konflikt stehende Marktpräsenz. Die für uns heute selbstverständlichen definitorischen Unterschiede zwischen Limonaden, Extrakten und alkoholfreien Bieren wurden dadurch vorgeformt.
Werbung und Vermarktung in Hamburg
Hamburg war der Geschäftssitz der American German Hopkos Company, hier musste ein Beispiel für das gegeben werden, was nachfolgend an anderen Orten und in anderen Ländern geschehen sollte. Wir hatten zuvor bereits die verbale Anpreisung des Bierersatzes genauer betrachtet, den Eigenlob, die Positionierung von Hopkos als Getränk für alle, die nicht länger am alten Bier, an schwachen Nichtalkoholika festhielten. Die Sprache war großspurig, herausfordernd, teils anmaßend – doch formal waren die ersten Anzeigen altbacken. Hopkos wurde in Hamburg nicht wirklich „amerikanisch“ beworben, fehlten doch die visuellen Marker entweder des Produktes selbst oder aber glücklich-überzeugter Konsumenten. Der Eindruck einer „amerikanischen“ Reklame gründete denn auch mehr auf der steten Präsenz der Werbebotschaften. Drei Phasen lassen sich grob unterscheiden.

Graphisch aufbereitete Kaskaden der Kaufgründe (Hamburgischer Correspondent 1903, Nr. 47 v. 29. Januar, 8 (l.); Hamburger Fremden-Blatt 1903, Nr. 91 v. 19. April, 24)
Von Ende Januar bis etwa Mitte April 1903 dominierten informierende, die Hauptanliegen der Selbstdarstellung gleichsam einhämmernde Anzeigen. Visueller Ankerpunkt war der Produktname, entweder markant wiederholt oder aber graphisch ansprechend aufbereitet. Die Annoncen erschienen in allen führenden Tageszeitungen Hamburgs, adressierten damit die gesamte Bevölkerung, Arbeiter, einfache Bürger, die urbane Kaufmannschaft. Das Einhämmern verankerte den Preis, die edle Grundlage von Hopfen und Malz, den hohen Nährwert, die Kampfstellung gegen das Bier, die repräsentative Kraft des Neuen, unbedingte Alkoholfreiheit und schließlich das duale Angebot einer hellen und einer dunklen Variante. Das war Überwältigungsreklame, zielte auf die Verankerung von Werbebotschaften im Hirn der Massen – und damit ihre bedingte Dressur für den Kauf, ging man damals doch noch von der starken Wirkungsmacht der Reklame aus.

Belehrung des Publikums über den wahren Preis (Hamburger Nachrichten 1903, Nr. 115 v. 10. März, 7)
Die gefühlte Überlegenheit der Hopkos-Macher führte denn auch dazu, dass man der sich in recht geringen Absatzzahlen niederschlagenden Ignoranz der Konsumenten durch belehrende Information begegnete. Hopkos war nicht billig: Zwar kosteten auch gängige Flaschenbiere zehn Pfennig pro Flasche, doch diese enthielten zwischen 0,3 und 0,4 Liter, während Hopkos in Fläschchen von lediglich 0,1 Liter verkauft wurde. In Gaststätten – und dort wurde die Masse des Bieres getrunken – lagen die Bierpreise nochmals niedriger. Außerdem verdoppelte sich der Einstiegspreis durch das Flaschenpfand von nochmals zehn Pfennigen. Die Macher ignorierten die damaligen Debatten über das Besitzrecht an gekauften Produkten und ihren Verpackungen. Und man unterstrich mit der oberen wieder und wieder geschalteten Anzeige, dass die kleine Erfrischung einen ganzen Groschen kostete. Bei Monatssalären von vielfach nur 60 bis 100 Mark, bei Frauen stetig weniger, war das eine Hürde, die den Massenabsatz deutlich begrenzte. Zudem waren derartige Nichtalkoholika auch in der Mitte der Gesellschaft vielfach noch nicht eingeführt. Die aufstrebende Hamburger Konsumgenossenschaft „Produktion“ verkaufte 1903 ihren etwa 15.000 Mitgliedern ganze 5186 Liter Saft und keine Limonaden (Konsum-, Bau- und Sparverein „Produktion“ zu Hamburg. Geschäfts-Bericht für das Fünfte Geschäftsjahr 1903, Hamburg 1904, 29).

Weg vom Alkohol, hin zur Abstinenz: Hopkos als Brückengetränk (Hamburgischer Correspondent 1903, Nr. 159 v. 4. April, 8)
Im März/April 1903 gab es weitere Anzeigenmotive – doch ihre Größe (und die Kosten) sank gegenüber den Einführungsmonaten. Man bewarb Hopkos als idealen, als wunderbaren Bierersatz, stellte nun jedoch auch einzelne Vorteile des Getränks besonders hervor. Zugleich positionierte man es noch deutlicher als Temperenzgetränk, als Novität mit einer hohen Mission.

Vermarktung im Schlagschatten der Abstinenz (Hamburger Fremden-Blatt 1903, Nr. 80 v. 4. April, 8)
Die zweite Phase reicht von Mitte April bis Mitte Mai. Den Machern dürfte damals deutlich geworden sein, dass die anvisierten Absatzzahlen kaum zu erreichen waren. Der Inhaber zog daraus Konsequenzen und sattelte auf den marktgängigeren Absatz von Backmischungen um. In dieser Phase dominierten neuerlich Textanzeigen. Im Gegensatz zur Einführungszeit bedienten sie nun jedoch höchst heterogene Themen, verbanden diese mit Hopkos. Parallel zu den Pferderennen in Hamburg Horn war es „ein totsicherer Tip im Kampfe des Lebens, im nimmer rastenden Rennen um die Gesundheit von Geist und Körper“, gleichermaßen geeignet „für Abstinenzler und Biertrinker“ (Hamburger Fremden-Blatt 1903, Nr. 97 v. 26. März, 24). Man grenzte sich ab von Konkurrenzangeboten, insbesondere zu dem in Hamburg produzierten Apfelpräparat Pomril, bemängelte dessen moderaten Alkoholgehalt, verwies dagegen auf die gutachterlich bestätigte Alkoholfreiheit. Man bettete dies aber auch ein in den Wettstreit der Völker, bei dem sich Zivilität in den Trinksitten manifestiere (Hamburgischer Correspondent 1903, Nr. 189 v. 24. April, 12). Hopkos, so die Aussage, erlaube „allen Alkoholgegnern die große Freude, daß sie jetzt Bier trinken dürfen, alkoholfreies Bier; denn Hopkos – der Name ist etwas schwer, und die Zunge macht jedesmal einen Hopser – enthält keinen Alkohol und besteht doch aus Malz und Hopfen“ (Hopkos, Märkischer Sprecher 1903, Nr. 111 v. 13. Mai, 7). Neben derartige redaktionelle Reklamen setzte man aber auch kleine Geschichten, gleichsam literarische Schleichwerbung, versah sie augenzwinkernd mit „Nachdruck erlaubt“: Ein Wagnersänger musste etwa trunken eine Lohengrin-Aufführung abbrechen, die gramgebeugte Gattin fragte einen alten Sanitätsrat um Rat. Nein, die Nerven seien wirklich ein Problem, Lampenfieber müsse bekämpft werden, Gesang und Durst seien eng miteinander verbunden. Einem Künstler Genüsse und Erfrischung zu verwehren sei kontraproduktiv. Nur gut, dass es Hopkos gebe, diese bierähnliche Stärkung aus der Flasche. Und der Sanitätsrat empfahl der Dame, „‚lassen Sie ihren Mann statt Bier nur noch Hopkos trinken. Er wird den Unterschied kaum merken und binnen kurzem der alte sein‘“ (Ewaldo v. Santen, Ein furchtbares Erlebnis, Hamburger Fremden-Blatt 1903, Nr. 91 v. 19. April, 27). Ja, die Welt war (und ist) einfach: Kaufen, Trinken, Gesunden…

Ein eingeführtes Getränk (Hamburger Echo 1903, Nr. 184 v. 9. August, 6)
Drittens: Nach dem erfolgreichen Umzug nach Uhlenhorst startete die Hopkos-Company dann von Mitte Mai bis Mitte August eine dritte Werbephase. Die Anzeigentaktung nahm neuerlich zu, eingesetzt wurden nun auch vereinzelte visuelle Elemente, etwa den schon oben präsentierten Wegweiser an den neuen Standort. Parallel weiteten sich die Themen, gab es formale Variationen. Hopkos wurde – im bürgerlichen Hamburg! – in vielfältigen Formen zum König der alkoholfreien Getränke gekrönt, erschien als Hilfsmittel gegen Durst und Trunkenheit, diente zugleich dem Kampf gegen „Nervosität, Armut, Zunahme der Verbrechen, Arbeitsscheu, Lebensüberdruss“ (Hamburger Neueste Nachrichten 1903, Nr. 149 v. 28. Juni, 14).
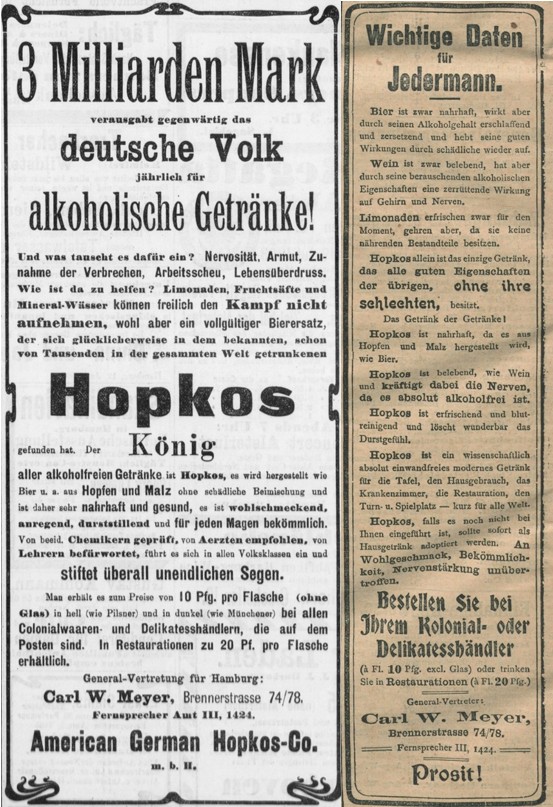
Hopkos als volkswirtschaftlicher Aktivposten, als König aller alkoholfreien Getränke, als Getränk der Getränke (Hamburgischer Correspondent 1903, Nr. 321 v. 12. Juli, 8 (l.); Hamburger Fremden-Blatt 1903, Nr. 191 v. 16. August, 16)
Neuerlich wurden die Vorteile des idealen Bierersatzes Hopkos aufgelistet und mit Ausrufungszeichen versehen. Es schien, als wolle man mit diesen unten abgebildeten Anzeigen den Verbraucher nochmals aufrütteln, während parallel die Geschäfte immer schlechter liefen. Die Werbesprache blieb appellativ-trotzig: „Das Getränk der Getränke! Hopkos ist nahrhaft, da es aus Hopfen und Malz hergestellt wird, wie Bier. Hopkos ist belebend, wie Wein und kräftigt dabei die Nerven, da es absolut alkoholfrei ist. Hopkos ist erfrischend und blutreinigend und löscht wunderbar das Durstgefühl. Hopkos ist ein wissenschaftlich absolut einwandfreies modernes Getränk für die Tafel, den Hausgebrauch, das Krankenzimmer, die Restauration, den Turn- u. Spielplatz – kurz für alle Welt. […] Prosit!“ (Hamburger Fremden-Blatt 1903, Nr. 191 v. 16. August, 16). Doch die erwünschte Resonanz blieb aus, auch wenn es an ironischer Unterstützung nicht fehlte. Ein abgelehnter Dichter musste lesen: „Ihr ‚Lied eines Wüstlings‘ ist so entsetzlich, daß wir uns nicht zum Abdruck entschließen konnten; einem Redakteur, der das durchlas, mußte sofort mit zwei Flaschen Hopkos wieder auf die Beine geholfen werden“ (Hamburgisches Fremden-Blatt 1903, Nr. 203 v. 30. August, 17).
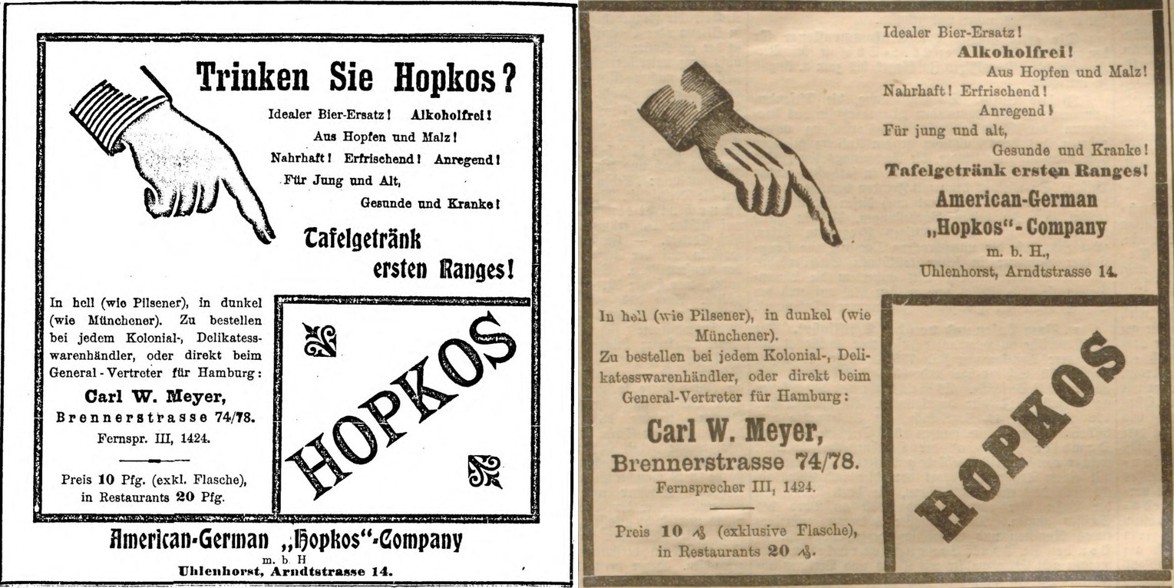
Ein Getränk für alle (Hamburger Anzeiger 1903, Nr. 174 v. 28. Juli, 5 (l.); Hamburger Echo 1903, Nr. 178 v. 2. August, 4)
Auch in dieser dritten Phase gelang es den Hopkos-Machern nicht, ihr Produkt zielgruppengenau anzudienen, den Ersatzbiergarten für alle zu verlassen: „Für Jung und Alt, Gesunde und Kranke!“ (Hamburgischer Correspondent 1903, Nr. 345 v. 26. Juli, 8). Ein Massengetränk müsse sich auch an die Masse der Konsumenten richten, dürfe nicht ausgrenzen. Dieses Credo mochte vielleicht in den vergleichsweise wohlhabenden, an Mittelstandsnormen und hochwertigen Standardprodukten angepassten Vereinigten Staaten gelten. In der hanseatischen Klassengesellschaft verfehlte eine derartige Werbung tendenziell die Absatzaufgaben. Die Hopkos-Macher adressierten zwar durchaus die „tapferen Frauen der arbeitenden Klasse“, präsentierten Hopkos aber nicht in deren Lebenswelt, sondern als Verbürgerlichungsgetränk, als Bestandteil einer vielfach verhassten fürsorglichen Belagerung just der Chemiker, Ärzte, Lehrer und Sozialpolitiker, die Hopkos warm empfahlen (Hamburger Echo 1903, Nr. 166 v. 19. Juli, 10).

Unterentwickelter Vertriebsweg Gaststätte: Hopkos-Bier und andere Limonaden (Harburger Anzeigen und Nachrichten 1903, Nr. 172 v. 25. April, 8 (l.); ebd. 1903, Nr. 241 v. 17. Juli, 8)
Überraschend war schließlich, dass Hopkos trotz aller Bemühungen um Akzeptanz der Lebensmittelhändler auf deren eigenständige Werbeunterstützung kaum zählen konnte. Die Hopkos-Werbung erfolgte zentral, nicht dezentral. Das galt selbst für Cafés und Restaurants, auch für die langsam wachsende Zahl der alkoholfreien Gaststätten.
Werbeträchtige Scheindebatten
Die Hopkos-Macher zogen in Hamburg allerdings eine bemerkenswerte Konsequenz aus den Marktauftritten alkoholfreier Konkurrenzprodukte, nicht nur von Methon. Sie inszenierten vermeintliche Angriffe, auf die sie dann souverän öffentlich reagierten. Damit nahm die American German Hopkos Company einerseits den bürokratisch-sachlichen Hinweisen der Untersuchungsämter präventiv Wind aus den Segeln, konnte anderseits aber den Blick der Verbraucher gezielt auf die scheinbar eindeutigen Vorteile von Hopkos lenken.
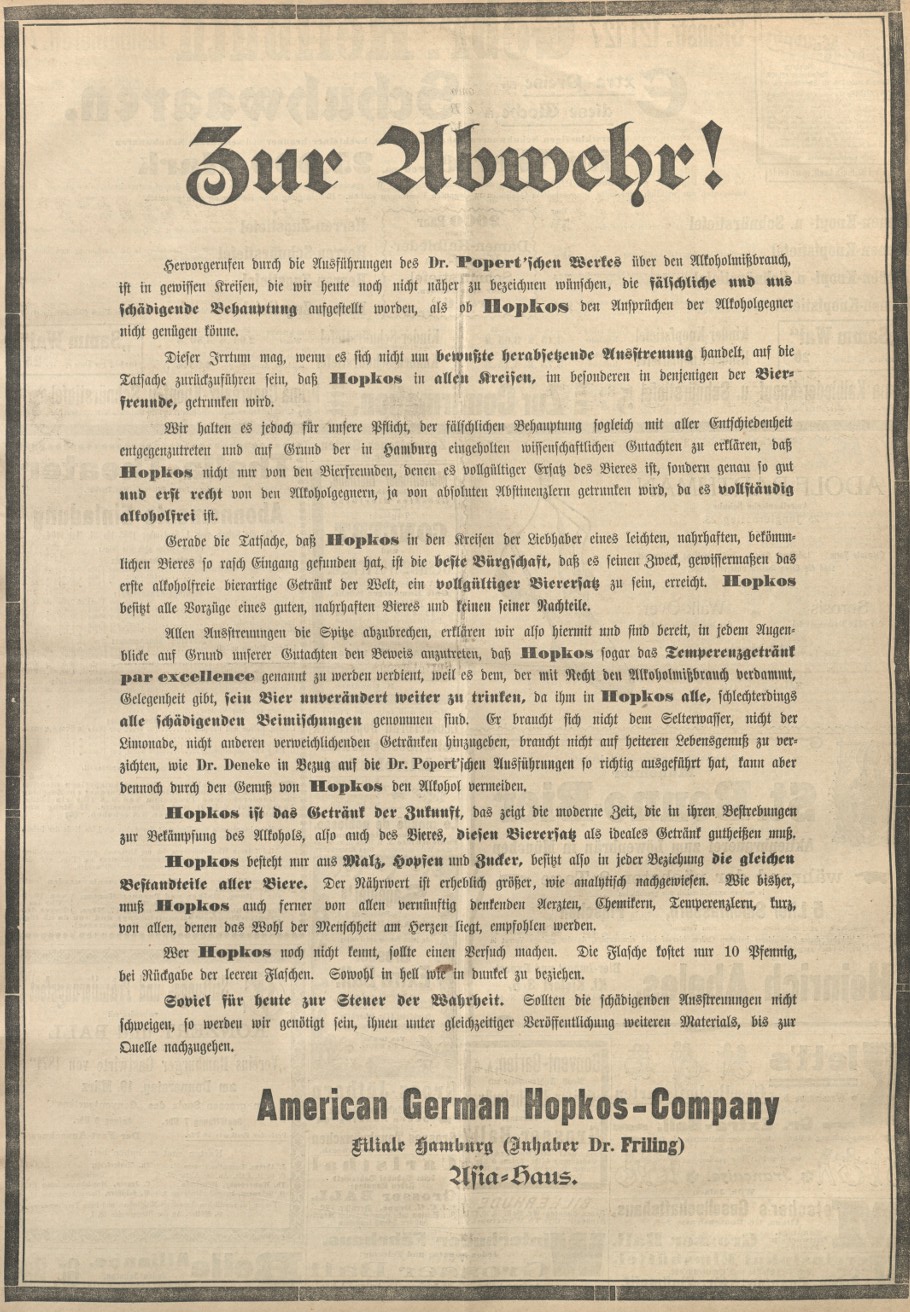
Volle Breitseite gegen Kritik am neuen Getränk (Hamburger Fremden-Blatt 1903, Nr. 63 v. 15. März, 15)
Anlass einer ganzseitigen „Zur Abwehr!“ übertitelten Anzeige war einerseits ein öffentlich kontrovers diskutiertes Anti-Alkoholpamphlet des Hamburger Richters Hermann Martin Popert (1871-1932), anderseits die Abwehr von nicht näher spezifizierten Vorwürfen, Hopkos sei nicht alkoholfrei. Popert hatte die negativen Auswirkungen aller Alkoholika beredt beschworen, ließ dabei das Bier nicht aus: „Vor allen Dingen sind die Brauereien und die Bierwirtschaften nicht minder Ausstrahlungspunkte schwerer nationaler Schädigung, als die Brennereien von Trinkbranntwein oder die Keller der Branntweinwirte“ (Hermann M. Popert, Hamburg und der Alkohol, Hamburg 1903, 49). Der Autor war eine schillernde Persönlichkeit, jüdischstämmiger Jurist, Schriftsteller, liberaler Bürgerschaftsabgeordneter und Guttempler. Mit seinem 1910 erschienen Erfolgsroman „Helmut Harringa“ veröffentlichte er einen Schlüsseltext der antimodernen und rassistischen Lebensreform (Kai Detlev Sievers, Antialkoholismus und Völkische Bewegung. Hermann Poperts Roman Helmut Harringa, Internationales Archiv für Sozialgeschichte der deutschen Literatur 29, 2004, 29-54). Popert schlug präzise Maßnahmen zur Austrocknung der Alkoholwirtschaft in Hamburg vor, darunter auch die öffentliche Förderung alkoholfreier Wirtschaften. Nichtalkoholika waren für ihn Garanten einer Umkehr von allgemeiner Entartung. Ein alkoholdürstendes Volk sei nicht in der Lage Weltgeltung und „Deutsche Seeherrschaft“ (Ebd., 51) zu erlangen.
Hopkos wurde nicht erwähnt, doch Poperts Aussagen konnten dem Absatz nur förderlich sein. Entsprechend lobte der Anbieter das Produkt als „vollgültiger Ersatz des Bieres […]. Hopkos besitzt alle Vorzüge eines guten, nahrhaften Bieres und keinen seiner Nachteile“. Es sei ein „Temperenzgetränk par excellence“, ignoriere auch nicht die auch von Popert propagierte Lebensfreude. Mäßige hatten dieses Recht eingefordert, verteidigten es in der intensiv geführten öffentlichen Debatte, da Alkoholtrinker ohne Pragmatismus nicht zu gewinnen seien ([Theodor] Deneke, Dr. H. Poperts Buch „Hamburg und der Alkohol“, Hamburger Fremden-Blatt 1903, Nr. 59 v. 11. März, 13). Hopkos wurde in diesen Scharmützeln nicht erwähnt, nicht als Hilfsmittel der Umkehr benannt. Die Anzeige sollte das Getränk propagieren, entsprechend erfand die Firma nicht näher bezeichnete schädigende „Ausstreuungen“. Das bewirkte sarkastische Antworten: Forderungen eines Guttemplers nach Zwangsmitgliedschaft von Arbeitern in dieser, gerade in Hamburg wichtigsten Abstinentenvereinigung konterte ein sozialdemokratischer Redakteur übersteigernd: „Natürlich! Und zugleich sollte man ihm die Verpflichtung auferlegen, täglich mindestens fünf Liter Pomril oder Hopkos zu konsumiren“ (Hamburg und der Alkohol, Hamburger Echo 1903, Nr. 65 v. 18. März, 5).
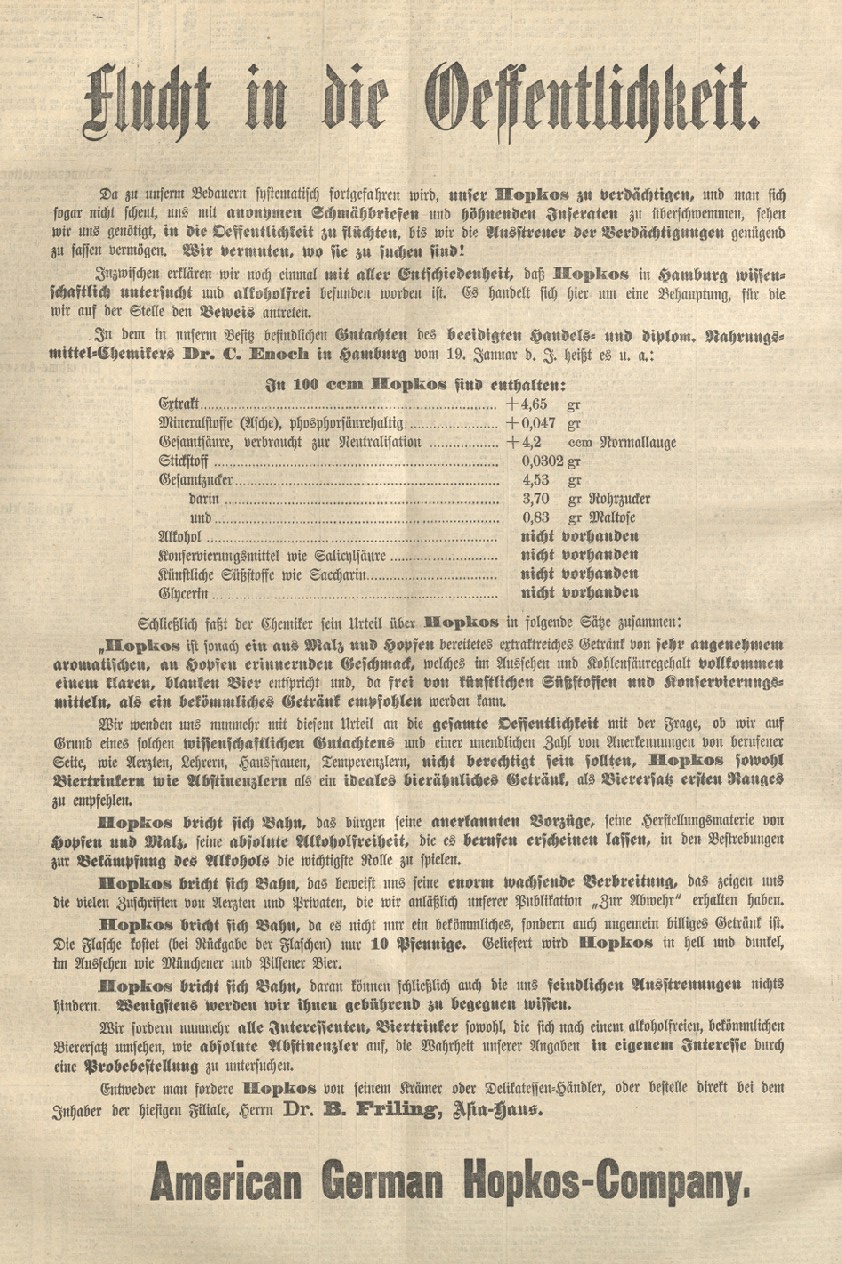
Nachgelegt: Hopkos als alkoholfreies Substitut für Bier (Hamburger Fremden-Blatt 1903, Nr. 71 v. 25. März, 24)
Derartiger Spott missfiel den Hopkos-Machern, eine weitere ganzseitige Stellungnahme folgte. Neuerlich sprach man dunkel von Schmähbriefen und Hohn. Dagegen erhob man sich wacker, betonte Wohlgeschmack und Alkoholfreiheit des Hopkos, präsentierte die Ergebnisse des bestätigenden Gutachtens des eigenen Mitarbeiters Carl Enoch. Und es folgte eine Eloge auf den „Bierersatz ersten Ranges“, billig und zukunftsträchtig. So brachte die Firmenleitung ihr Getränk in die Diskussion – zu allerdings hohen Kosten: Die beiden Inserate im Fremden-Blatt kosteten 316,80 Mark; und sie wurden auch in den günstigeren Hamburger Nachrichten veröffentlicht (Hamburger Fremden-Blatt 1903, Nr. 74 v. 28. März, 17). Wie sehr es in dieser Debatte allein um Publizität ging, unterstrichen zwei gleichartige, mehr als drei Monate später mit anderen Einleitungen versehene Anzeigen der Frankfurter Hopkos-Gesellschaft (Frankfurter Zeitung 1903, Nr. 177 v. 28. Juni, 4. Morgenbl., 4; ebd. , Nr. 174 v. 25. Juni, 3. Morgenbl. 3). Pseudodebatten und erfundene Niedertracht gehörten zur Präsentation von Hopkos.
Verdammung durch die Brauwirtschaft
Empörung über derartige Machenschaften ist kaum angebracht, denn solches Gebaren gehörte zum wirtschaftlichen Wettbewerb. Plagiatsvorwürfe durchzogen damals die Gazetten, Verfahren wurden vielfach angestrengt, um Strafbefehle von zehn, fünfzig, hundert Mark öffentlich annoncieren zu können, um die eigene Ehrsamkeit und Rechtschaffenheit dann angemessen zu beleuchten. Die American German Hopkos-Company schwieg allerdings ihre profunden Kritiker öffentlich tot, schuf also lediglich eine Werbewelt eigener Qualität. Das betraf die Analysen und Rückfragen der Untersuchungsämter, das betraf aber vor allem die Kritik der Brauer, die am vermeintlichen Bierersatz Hopkos kein gutes Haar ließen.
Deutsche und böhmische Fachzeitschriften berichteten anfangs durchaus sachlich über die neu gegründete Hamburger Gesellschaft, um dann gleich in die Hörner der Abwehr und Verdächtigung zu stoßen: „Wieder einmal ein Ersatz für Bier! Es wäre wahrlich höchste Zeit, daß sich die Sanitätsbehörden mit derlei problematischen Erzeugnissen etwas eingehender befassen sollten, als dies bisher der Fall gewesen“ (Alkoholfreier Schwindel, Gambrinus 30, 1903, 193; Hopkos, Zeitschrift für das gesammte Brauwesen 26, 1903, 291). Die Einlassungen der Brauwirtschaft spiegelten die vielgestaltigen Verwerfungen des Fin de Sieclé, verteidigte sie mit dem Bier doch nicht nur ihr eigenes Geschäft, sondern zugleich das tradierte Leben vor den Herausforderungen einer rasch vorwärtsdringenden Moderne. Die Kritik war vielfach zutreffend, seitens der sich in den Jahrzehnten zuvor grundstürzend modernisierten Brauwirtschaft aber doch überraschend und selbstblind. Die Antialkoholbewegung wurde nicht als Resultat verbesserter physiologischer und medizinischer Kenntnisse verstanden und ernstgenommen, sondern als eine aus dem Norden nach Süden vordringende utopisch-kreischende Bewegung, deren Vertreter man eigentlich, wie die Vegetarier, als Sonderlinge ignorieren müsse. Produkte wie Hopkos hätten dies jedoch verändert, „die nur schlecht eingewurzelte, künstlich genährte Pflanze treibt nämlich giftige Blüten mit hochtönenden Namen, gar wundersam anzusehen.“ Hopkos verkünde lautstark, gesünder als Bier zu sein, dieses verdrängen zu können. „Diese in echt amerikanischer Manier veröffentlichte Reklame ist offenbar ein Attentat auf die Leichtgläubigkeit des Volkes, und es ist nun unsere Pflicht, in dieser Angelegenheit ein offenes fachmännisches Wort zu sprechen, damit nicht tausende von Personen, welche das gedruckte Wort als ein Evangelium betrachten, diesem Humbug zum Opfer fallen.“ das tradierte Gute stand dem anmaßenden Neuen gegenüber: „Das tatsächlich aus Hopfen und Malz erzeugte Bier, das seit Jahrhunderten von aller Welt getrunken und verehrt wurde, ist zum Kampfobjekt der Abstinenzler geworden, das ‚Hopkos‘ aber, ein auf chemischem Wege erzeugtes Getränk, das niemals aus Malz und Hopfen erzeugt sein kann, dieses Getränk also, das der Gesundheit kaum zuträglich sein kann, wird dem Volke als Genußmittel angepriesen! Eine große Gesellschaft mit bedeutenden Mitteln konstituiert sich, die Behörden geben auch noch ein Patent auf dieses Produkt, Agenten durchziehen das Reich und machen Proselyten und das Volk, welches sich zum Genuß des ‚Hopkos‘ verleiten läßt, wird geschädigt, den Vorteil einzig und allein haben die ausländischen Unternehmer, die ‚Hopkos‘-Company, welche sich mit den im Schweiße seines Angesichtes verdienenden Hellern des Arbeiters die Tasche füllen und schließlich, wenn das Volk zur Einsicht gekommen sein wird – liquidieren.“ Die Untersuchungsbehörden müssten einschreiten, denn letztlich würden solche Unternehmen den monarchischen Staat, die mittelständische Gesellschaft unterminieren. „Geradezu frech“ sei es zudem, dass derartige Produkte von Wissenschaftlern verteidigt würden. Als Sachwalter des Gemeinwohls müsse die Brauwirtschaft daher „das Volk eindringlich vor dem Genusse eines Getränkes, das bisher unbekannt war und es noch ist“ warnen (Zitate n. Ein Appell an die Sanitätsbehörden, Gambrinus 30, 1903, 704-705). Antiamerikanismus, Antikapitalismus, Ideen eines einheitlichen Volkskörpers, einer einheitlichen Wissenschaft, Vorstellungen von Überfremdung und Angst vor der Innovationsflut der Moderne; all dies findet sich hier, hatte über die damalige Mittelstandsbewegung auch beträchtliche politische Auswirkungen. Die Abwehr von Hopkos ging weit über das Trinken oder Nicht-Trinken einer trügerisch beworbenen Getränkeinnovation hinaus. Hopkos war auch Projektionsfläche vielfach nicht erwünschter, gleichwohl kaum zu stoppender Veränderungen des Alltagslebens, der Kommerzialisierung zumindest des urbanen Alltags.

Beschwörung des Alten: Selbstdarstellung der Münchener Braukunst 1905 (Münchener Bier-Chronik 1905, Ausg. v. 1. September, 1)
Entsprechend wurden die neuen alkoholfreien Getränke nicht distanziert analysiert, auch die damit verbundenen eigenen Marktchancen außer Acht gelassen: Es hieß, „die Fabrikanten der alkoholfreien Getränke treiben ein gefährliches Spiel mit ihren Anpreisungen von chemischen Produkten“ (Alkoholfrei, Gambrinus 30, 1903, 830, auch zum Folgenden). Immer wieder forderten die Brauereivertreter das scharfe Schwert der Wissenschaft, forderten Enthauptungsschläge gegen die Konkurrenz. Sie ignorierten, dass die neuen Produkte zumeist nicht gesundheitsschädlich – und wirtschaftliche Schädigungen kaum nachweisbar waren. Sie warnten vor zeittypischen Getränken, etwa Ceres-Fruchtsäften, Bilz-Brause und eben auch Hopkos, während sie die Gründe für den im Deutschen Reich seit 1900 zurückgehenden Bierkonsum nur unwillig in den Blick nahmen. Die Kritik am Neuen sollte die Reihen schließen und führte zu einer Wagenburgmentalität der Branche, die apodiktisch verteidigte statt sich zu verändern. Typisch dafür war das unausgesprochene Verbot als Brauer „alkoholfreie Biere“ zu produzieren und anzubieten. Das veränderte sich langsam, Trinkmit der Bochumer Schlegel-Brauerei war später eine seltene und doch zukunftsweisende Ausnahme.
Die Kritik der Brauer an Hopkos und ähnlichen Getränkeinnovationen unterstrich aber auch die beginnende Stagnation des Braugewerbes, dessen Symbol die rechtlich verbindliche Festschreibung des Reinheitsgebotes im gesamten deutschen Braugebiet 1906 war. Man wetterte gegen die „Abstinenzfanatiker“ (Cluss, Die wichtigsten Gesichtspunkte der Alkoholfrage vom Standpunkte der Mässigkeit. II, in: Letter on Brewing 6, 1906, 80-99, hier 91), gegen ihre unanständige Propaganda, ihre steten Unwahrheiten und Übertreibungen. Die neuen Getränke, „dargeboten unter sprechenden Phantasienamen wie „‚Methon‘, ‚Hopkos‘, ‚Pomril‘, ‚Kaiserperle‘, ‚Edelblume‘ u.s.w.“ (Ebd., 95), lehnten sie sämtlich ab, verwiesen auf das gute altbewährte Bier mit seinem nur geringen Alkoholgehalt. Anbieter wie die Hopkos-Company – aber auch die Brauer folgten den eigenen Narrativen, blickten nicht über den Glasrand hinweg (vgl. Birgit Speckle, Streit ums Bier in Bayern. Wertvorstellungen um Reinheit, Gemeinschaft und Tradition, Münster 2001, 197-206). Diese allseits bestehende Ignoranz gegenüber konfligierenden Ansprüchen begünstigte in den USA den Weg in die Prohibition, die sich die erfolgsverwöhnten Brauer letztlich nicht vorstellen konnten, gegen die sie zu spät aufbegehrten (Thomas Welskopp, Amerikas große Ernüchterung. Eine Kulturgeschichte der Prohibition, Paderborn 2010, 11-50). Die wechselseitigen Attacken von Brauern und Anbietern neuartiger Nichtalkoholika führten auch in Deutschland zu einer Versäulung der jeweiligen Vorstellungen vom richtigen und falschen Trinken.
Nationale Expansion: Hopkos-Lizenznehmer im Deutschen Reich
Die seit spätestens Februar 1903 laufenden Bemühungen um Franchisenehmer hatten im Deutschen Reich nur gegrenzten Erfolg. Die Hamburger Hopkos-Zentrale lieferte zwar Maschinen, Extrakte und Werbevorlagen, erlaubte vor Ort durchaus eigenständige Marketingmaßnahmen, doch die Verträge engten die lokalen Aktivitäten auch ein, wurden lokale Besonderheiten doch kaum berücksichtigt. Insbesondere der reichsweit einheitliche Verkaufspreis war zu hoch, schon für eine einkommensstarken Standort wie Hamburg, gewiss aber für wirtschaftlich schwächere Regionen. Auch gleichartige Werbung war im regional heterogenen deutschen Föderalstaat nicht immer ein Vorteil. Unser kurzer Überblick wird sich daher vor allem auf lokale Besonderheiten und das für ein Franchise-Geschäft typische Spannungsgefüge zwischen Lizenzgeber und -nehmer konzentrieren. Drei Beispiele also, Frankfurt a.M./Wiesbaden, Berlin und Ennigerloh, zudem ein Memento zu Beginn.
Eine Leipziger Gesellschaft wurde aller Wahrscheinlichkeit schon im Februar 1903 vertraglich vorbereitet, doch sie entfaltete vor Ort kaum Wirkung (Leipziger Tageblatt 1903, Nr. 96 v. 22. Februar, 1356). Die Bremer American German Hopkos Company wurde am 14. Mai 1903 mit einem Stammkapital von 30.000 M gegründet, das im März 1904 gar auf 39.000 M erhöht wurde (Deutscher Reichsanzeiger 1903, Nr. 117 v. 19. Mai, 13; ebd. 1904, Nr. 73 v. 25. März, 29). Die Gesellschaft bemühte sich neben dem Kerngeschäft um die Etablierung von Filialen im Großherzogtum Oldenburg (Nachrichten für Stadt und Land 1903, Nr. 164 v. 16. Juli, 4; Jeversches Wochenblatt 1903, Nr. 195 v. 21. August, 3). Der Erfolg blieb aus, die Firma wurde am 4. April 1904 aufgelöst, erlosch nach erfolgreicher Liquidation im Januar 1907 (Deutscher Reichsanzeiger 1905, Nr. 104 v. 3. Mai, 25; ebd. 1907, Nr. 31 v. 2. Februar, 20).
Das erste Beispiel führt uns nach Frankfurt a. M. und die benachbarte Kur- und Residenzstadt Wiesbaden. Als Handelsstadt mit Hafen und rasch wachsender Industrie war die frühere Freie Hansestadt mit Hamburg durchaus vergleichbar. Die American German Hopkos Company W. & P. Foucar begann am 15. April 1903, Gesellschafter waren der Kaufmann Wilhelm Foucar und seine Gattin Paula (Deutscher Reichsanzeiger 1903, Nr. 111 v. 12. Mai, 27). Wilhelm Foucar hatte zusammen mit seinem Bruder 1900 die zuvor von seinem Vater Heinrich Wilhelm Foucar, einem seit 1870 in der Rheinprovinz tätigen Kaufmann, geführte Firma Foucar & Bender in eine neue Handelsgesellschaft überführt (Deutscher Reichsanzeiger 1899, Nr. 175 v. 27. Juli, 7; ebd. 1900, Nr. 38 v. 10. Februar, 15). Für das noch junge Ehepaar schien Hopkos eine Chance der Emanzipation vom Familienverband und eine selbstbestimmte Zukunft zu sein.

Tagesproduktion 12.500 Flaschen, Frankfurter Zeitung 1903, Nr. 132 v. 13. Mai, 1. Morgenbl., 4)
Die Foucars übernahmen Technik, Grundstoffe und Flaschen aus Hamburg, setzen aber von Beginn an eigene Akzente in der Werbung. Die Charakteristika wurden dem Publikum zwar ebenso eingehämmert, doch die Werbeklischees von Beginn an variiert (Frankfurter Israelitisches Familienblatt 1, 1902/03, Nr. 28, 8). Dicke Ränder sorgten in der werblich eher rückständigen Frankfurter Zeitung für besondere Aufmerksamkeit, zudem informierte man aus Renommeegründen genauer über den Geschäftsgang. 12.500 Flaschen Hopkos sollen Anfang Mai produziert worden sein, ein beachtlicher Wert auch für eine Metropole mit mehr als 300.000 Einwohnern und einem dicht besiedelten Umfeld. Die Frankfurter Dependance listete zudem mehrfach die Hopkos-Niederlagen auf, Läden also, in denen man den Bierersatz sicher kaufen konnte. Schon im Mai standen unter den Anzeigen 89 Adressen, darunter auch der aufstrebende Lebensmittelfilialist Jakob Latscha. Parallel hatte man früh fünf Generaldepots in Hanau, Cronberg, Oberursel, Hofheim und Darmstadt eingerichtet (Frankfurter Zeitung 1903, Nr. 136 v. 17. Mai, 1. Morgenbl., 4). Die Firma expandierte auch weiter gen Norden, etwa nach Gießen (Gießener Anzeiger 1903, Nr. 117 v. 20. Mai, 4).

Ein alkoholfreies Getränk in kleinen Bierflaschen – gleichwohl ein großes Kampfmittel gegen Siechtum und Tod (Frankfurter Zeitung 1903, Nr. 155 v. 6. Juni, 3. Morgenbl., 4 (l.); ebd., Nr. 136 v. 17. Mai, 1. Morgenbl., 4)
Selbstbewusst schuf das Ehepaar Foucar eigene Werbemittel, führte Hopkos damit den Kunden genauer vor Augen, griff in Illustrierten und Karikaturzeitschriften schon länger übliche Werbetrends auf. Selbstbewusst zettelte das Duo auch Scheinfehden an, um Hopkos in der Öffentlichkeit als hochwertiges, wohlschmeckendes und vor allem alkoholfreies Getränk zu etablieren (Frankfurter Zeitung 1903, Nr. 174 v. 25. Mai, 3. Morgenbl., 3; ebd., Nr. 177 v. 28. Juni, 4. Morgenbl., 4).

Produktdiversifizierung als Grundlage für höhere Krisenfestigkeit (Neues Adressbuch für Frankfurt am Main und Umgebung 1904, T. III, 2 (l.); ebd., T. I, 28)
Die American German Hopkos Company W. & P. Foucar offerierte neben dem Bierersatz eine breitere Palette alkoholfreier Getränke, darunter das Kunstgetränk Calvella, Ersatz des am Main so wichtigen Apfelmosts. Entsprechend glaubte man sich von dem Konkurs der Hamburger Zentrale abkoppeln zu können, versprach nicht nur von Hopkos, sondern auch die „künstlichen Mineralwässern und Limonaden“ weiterproduzieren zu wollen (Ebd. 1904, Nr. 77 v. 17. März, 1. Morgenbl., 3). Gleichwohl musste das Frankfurter Franchise-Unternehmen kurz darauf Konkurs anmelden und wurde am 24. Januar 1905 aufgelöst (Deutscher Reichsanzeiger 1905, Nr. 30 v. 3. Februar, 14). Das Ehepaar Foucar verschwand, war im August 1905 nicht mehr greifbar, als die Berliner Annoncenexpedition Haasenstein & Vogler versuchte, ausstehende Insertionszahlungen in Höhe von 2.283,77 Mark einzuklagen (Deutscher Reichsanzeiger 1905, Nr. 197 v. 22. August, 6).
Die Dezentralisierung des Hopkos-Lizenzgeschäftes wurde von den Foucars konsequent vorangetrieben, Hopkos war im zentralhessischen Raum allseits präsent. Wiesbaden, die Hauptstadt der preußischen Provinz Hessen-Nassau, wurde dem alteingesessen Handelsunternehmen Carl Doetsch übertragen, das 1879 vom gleichnamigen Weinhändler gegründet, 1889 aber an neue Eigentümer verkauft worden war (Deutscher Reichsanzeiger 1879, Nr. 46 v. 22. Februar, 6; ebd. 1889, Nr. 58 v. 28. Februar, 13). Auch in Wiesbaden griff man auf die Hamburger Werbevorlagen zurück, veränderte sie aber mit Regionalbezug. Der ‚Dorscht‘ der Hessen wurde beschworen, die hohen Preise des lokalen Apfelweins beklagt, das vermeintlich amerikanische Hopkos gepriesen. Man reduzierte den Hopkos-Preis in Gaststätten auf fünfzehn Pfennig, fünf Pfennig niedriger als andernorts (Ein billiges, nahrhaftes und erfrischendes Getränk, Wiesbadener Tagblatt 1903, Nr. 292 v. 27. Juni, Morgenausg., 3). Einheimische und auch Touristen durften Hopkos vor Ort kostenlos probieren, Koppeleffekte auf andere Orte wurden erhofft (Wiesbadener Streifzüge, Wiesbadener General-Anzeiger 1903, Nr. 160 v. 12. Juli, 1).

Einführung in Wiesbaden mit Proben (Wiesbadener Tagblatt 1903, Nr. 280 v. 19. Juni, Abendausg., 7)
In Wiesbaden war die Werbung variantenreich, doch es blieb zumeist bei gestalteten Textanzeigen, die regelmäßig die lokalen Hopkos-Händler auflisteten. Wurden Ende Juni zwanzig Namen genannt, waren es Anfang Juli schon 93, Anfang August schließlich 109 Niederlagen (Wiesbadener General-Anzeiger 1903, Nr. 144 v. 25. Juni, 7; ebd., Nr. 156 v. 8. Juli, 6; ebd., Nr. 177 v. 1. August, 5). Hinzu kamen Anfang Juli gezielte Hinweise auf immerhin zwölf „Ausschänkstätten“ (Wiesbadener Bade-Blatt 1903, Nr. 182 v. 2. Juli, 34). Das galt auch für übliche Cafés und Gaststätten, nicht nur für das alkoholfreie Restaurant „Zur Gesundheit“ (Wiesbadener Tagblatt 1903, Nr. 561 v. 2. Dezember, Morgenausg. 12).

Aufbau eines lokalen Vertriebsnetzes in Wiesbaden (Wiesbadener Tagblatt 1903, Nr. 286 v. 23. Juni, Abendausg. 10)
Die zeitlich begrenzte Vertretung von Hopkos war für das Wiesbadener Generaldepot Carl Doetsch wahrscheinlich erfolgreich. Die Großhandelsfirma belieferte ihre Kunden mit einer ganzen Palette alkoholfreier Markenartikel und auch eigener Handelsmarken (Wiesbadner General-Anzeiger 1904, Nr. 19 v. 23. Januar, 7). Hopkos war im Vergleich zu anderen Reformwaren relativ billig, ein Einstiegprodukt für solvente Interessenten. In Wiesbaden wurde es bis Mitte 1904 verkauft (Wiesbadener General-Anzeiger 1904, Nr. 56 v. 6. März, 6: ebd. Nr. 113 v. 15. Mai, 5; ebd., Nr. 167 v. 20. Juli, 12).
Das zweite Beispiel führt uns nach Berlin, gewinnen wir dort doch nähere Informationen über die Vertragsverhältnisse, die Größe der dezentralen Betriebe und die bisher ja völlig ausgeblendeten Beschäftigungsverhältnisse. Die Berliner Hopkos-Gesellschaft mit beschränkter Haftung wurde relativ spät gegründet (Volks-Zeitung 1903, Nr. 300 v. 30. Juni, 3). Der Etablierung am 27. Juni 1903 waren jedoch lange Verhandlungen vorausgegangen, ging es doch um „den Kauf einer Fabrikanlage mit Maschinen und Zubehör und die Lizenz, betreffend die ausschließliche Herstellung und den ausschließlichen Vertrieb des ‚Hopkosgetränkes‘ für den gesamten Postbezirk Berlin (Berliner Börsen-Zeitung 1903, Nr. 304 v. 2. Juli, 21). Die Verhandlungen hatten im Februar mit einem Vorvertrag begonnen, ein Zessionsvertrag vom April regelte Kreditlinien und Anteilsrechte der Hamburger Zentrale. Das Stammkapital lag schließlich bei 120.000 M, die Geschäftsführung teilten sich der Schöneberger Kaufmann Wolf Cohn und der Berliner Ingenieur Johannes Brandes (Deutscher Reichsanzeiger 1903, Nr. 154 v. 3. Juli, 13). Rasch zeigten sich Friktionen, die Geschäftsführung wurde bereits nach knapp zwei Wochen ausgetauscht (Ebd., Nr. 164 v. 15. Juli, 10).

Übernahme und Variation Hamburger Werbeklischees in der Reichshauptstadt (Vorwärts 1903, Nr. 119 v. 24. Mai, 14 (l.); ebd., Nr. 125 v. 31. Mai, 13)
Auch in Berlin war Hopkos zeitweilig breit präsent, konnte etwa in den ca. 300 Filialen der Likörfabrik, Weingroßhandlung, Fruchtsaftpresserei, Mineralwasser- und Schaumwein-Fabrik Hermann Meyer & Co. gekauft werden (Vorwärts 1903, Nr. 125 v. 31. Mai, 133). Ähnliches galt für die in Berlin besonders wichtigen Flaschenbiergroßhandlungen. Das Geschäft wurde allerdings durch ein behördliches Verkaufsverbot vom 20. Oktober bis 28. November 1903 begrenzt (Berliner Börsen-Zeitung 1903, Nr. 557 v. 28. November, 14). Ende Januar 1904 konnte man die Groß-Berliner Lizenz und den Maschinenpark dann „unter coulanten Bedingungen“ erwerben (Berliner Tageblatt 1904, Nr. 51 v. 29. Januar, 11). Es folgte die Zahlungseinstellung und am 12. April 1906 schließlich die Löschung der Berliner Hopkos-Gesellschaft (Berliner Börsen-Zeitung 1906, Nr. 179 v. 18. April, 14).
Die im Herbst 1903 auch öffentlich diskutierte Absatzkrise erlaubt genauere Einblicke in den Geschäftsgang. Die in der Chausseestraße 3 gelegene Hopkos-Fabrik beschäftigte anfangs etwa fünfzehn Arbeiter und sieben Kutscher. „Da das Unternehmen aber finanziell sehr schlecht fundiert war und das Fabrikat auch nicht genügend Abnehmer fand, verkrachte die Gesellschaft bereits nach einigen Monaten. Der Konkurs wurde zwar angemeldet, doch wegen Mangel an Masse zurückgewiesen. Schon während der ersten Monate war das Personal verringert worden, so daß zuletzt noch zwei Kutscher, drei Kellerarbeiter und eine Buchhalterin verblieben“ (Vorwärts 1903, Nr. 240 v. 14. Oktober, 9). Lohn wurde keiner mehr gezahlt, die Ansprüche addierten sich. Doch die komplexen Vertragsverhältnisse erschwerten den Regress, derweil beträchtliche Teile des Inventars verkauft wurden. Dem Rechtsanwalt der Arbeiter gelang es, die maschinelle Grundausstattung vor dem Verkauf zu retten. Dennoch bekamen seine Mandanten ihre zwischen 75 und 300 Mark liegenden Forderungen nicht erstattet, da es vorrangige Mietschulden gab. Die öffentlich angegriffene Berliner Hopkos-Gesellschaft verwies den sozialdemokratischen Vorwärts auf die bestehende Rechtslage. Der Zessionsvertrag begünstige einige Gläubiger, auch Zugriffsrechte der Hamburger Zentrale unterbänden die Lohnzahlung an die Beschäftigten (Vorwärts 1903, Nr. 251 v. 27. Oktober, 10-11). Das sind bis heute vielfach typische Folgen eines auf Franchise aufbauenden Geschäftsmodells. Deutlich wird aber auch, dass der Berliner Lizenznehmer – und gewiss nicht nur dieser – seit Spätsommer 1903 vornehmlich abwickelte. Hopkos scheiterte rasch, an fehlendem Betriebskapital, vor allem aber am fehlenden Absatz. Die anfangs ausgegebenen „Rentabilitäts-Nachweise“ trogen, gründeten auf illusionären Erwartungen.
Das dritte Beispiel führt uns von der Reichshauptstadt in die westfälische Provinz, nach Ennigerloh, einer landwirtschaftlich geprägten Gemeinde mit etwa 1.500 Einwohnern. Es erlaubt einerseits Einblicke in die sozialen und wirtschaftlichen Verhältnisse der Lizenznehmer, unterstreicht anderseits die trotz Verträgen nicht unbeträchtliche unternehmerische Freiheit fernab der Zentrale in Hamburg.

Bierersatzwerbung im Münsterland und in Ostfalen (Die Glocke 1903, Nr. 106 v. 9. Mai, 3 (l.); Bielefelder Volks-Zeitung 1903, Nr. 128 v. 6. Juni, 8)
Die American-German ‚Hopkos‘ Company Badde & Schlemann in Ennigerloh hatte bereits am 1. April 1904 ihren Betrieb aufgenommen (Münsterischer Anzeiger 1903, Nr. 253 v. 1. Mai, 3). Die treibende Kraft war der als Prokurist fungierende Heinrich Schlemann. Er war ehedem Landwirt, seit 1900 Mitinhaber eines lokalen Wasserkalkwerks (Bielefelder Volks-Zeitung 1900, Nr. 79 v. 3. April, 5). Der Betrieb scheiterte, über das Vermögen Schlemanns wurde 1902 der Konkurs eröffnet, 1905 schließlich aufgehoben (Ebd. 1902, Nr. v. 20. Mai, 4; ebd. 1904, Nr. 52 v. 4. März, 3; Deutscher Reichsanzeiger 1905, Nr. 44 v. 20. Februar, 42). Der lokale Absatz des alkoholfreien Bieres verlief in den gängigen Bahnen, Hopkos-Klischees buhlten in der westfälischen Provinz um Käufe. Der Absatz dürfte überschaubar gewesen sein.
Doch Schlemann sah, ebenso wie zuvor Konstantin Delpy in Hamburg, im Hopkos-Konkurs eine Chance. Er gründete im September 1904 mit Hilfe seiner Frau Anna die Mineralwasserfabrik Dr. Tietzsch u. Schlemann (Deutscher Reichsanzeiger 1904, Nr. 264 v. 8. November 1904, 29). Sie produzierte das von Carl Enoch entwickelte, von der Hopkos-Gesellschaft vermarktete Erfrischungsgetränk Calvina und das neu kreierte Mineralwasser Heinrichs-Sprudel, ein mit Kohlensäure angereicherten Trinkwasser. Die Geschäftsidee war, die „teueren natürlichen Mineralwässer“ durch „ein billiges Tafelwasser“ zu ersetzen; ein Geschäft, das heutzutage Groß- und Handelskonzernen hohe Gewinne sichert (Bielefelder Volks-Zeitung 1904, Nr. 266 v. 19. November, 12).

Angebote über Bande: Calvina, Mineralwasser und Alkoholika (Die Glocke 1904, Nr. 243 v. 21. Oktober, 4)
Nach dem beendeten Konkurs und dem Selbstmord des Kompagnons Rudolf Tietzsch, der, „ein bedauernswerter Mann ohne sittlichen Halt“, zuvor in Berlin die „letzten Reste seines Vermögens durchgebracht hatte“ (Bielefelder Volks-Zeitung 1905, Nr. 96 v. 27. April, 2) gründete der wieder voll handlungsfähige Heinrich Schlemann im August 1905 die Schlemann & Co. GmbH. Mit einem Stammkapital von 21.000 Mark produzierte sie, wie die Internationale Hopkos-Gesellschaft, alkoholfreie Fruchtextrakte und weitere alkoholfreie Getränke.

Fortsetzung Calvinas unter neuem Namen und neuer Flagge (Warenzeichenblatt 1906, 51)
Schlemanns Kalvina war eine eingedeutschte Reminiszenz an die American German Hopkos Company, in dessen im August 1905 beantragten Warenzeichen der Adler nunmehr allein die deutsche Fahne in seinen Klauen hielt. Es ist unklar, wie lange dieses alkoholfreie Erfrischungsgetränk in der westfälischen Provinz verkauft wurde. Die Ennigloher American-German Hopkos Company erlosch jedenfalls am 10. Januar 1909 (Bielefelder Volks-Zeitung 1909, Nr. 12 v. 16. Januar, 4). Sie war der letzte noch bestehende deutsche Lizenznehmer der einstmals verheißungsvoll gestarteten Hamburger Hopkos-Zentrale. Schlemann arbeitete anschließend wohl als Landwirt resp. im lokalen Hotel seines Bruders und nach dem Krieg unter anderem als Repräsentant einer Weinfirma (Die Glocke 1922, Nr. 17 v. 21. Januar, 5). Die schnelle Mark dürfte er nicht gemacht haben, auch wenn er auf die Disruptionen seines Umfeldes professionell reagiert hatte.
Weltgeschäft: Hopkos in Auslandsmärkten
Weltgeschäft… Dieser Begriff ist bei Franchiseunternehmen wie Hopkos eigentlich immer mitzudenken, selbst im Zeitalter von Nationalismus und Imperialismus. Es galt ein erfolgreiches Modell zu etablieren, dieses dann wieder und wieder zu reproduzieren. Franchiseunternehmen sind Spekulationen auf geringe Unterschiede im Konsumverhalten großer Konsumentengruppen. Die Macher sahen Hopkos als einen innovativen Traditionsbrecher, der länderübergreifend Erfolg haben würde. In der Tat gelang der Verkauf von Hopkos-Lizenzen auch außerhalb des Deutschen Reiches. Hopkos repräsentierte in allerdings gebrochener Weise den für viele Nahrungsmittelbranchen typischen Erfolg deutscher Grundstoffe und Maschinen (Manz und Spiekermann, Making Food Empires, Oxford 2026 (i.E.)). In den meisten anvisierten Ländern scheiterte Hopkos jedoch.
Der Blick über die Grenzen lehrt erst einmal, dass das seit 1900 geschützte Warenzeichen schon vor dem Ankauf der Rechte durch die American German Hopkos Company genutzt wurde. 1901 wurde die Ausfuhr von „Hopkos (Ersatz für Weizen-Malz-Bier)“ nach Russland offiziell genehmigt (Deutscher Reichsanzeiger 1901, Nr. 275 v. 19. November, 6; Deutsches Handels-Archiv 1902, 54). 1902 konnte man es durch den Zürcher Unternehmer Albert Bruhin beziehen. Er gehörte zu den Pionieren der Produktion alkoholfreien Bieres in der Schweiz, verkaufte seine Schweizerische Fabrik zur Herstellung alkoholfreier kohlensäurehaltiger Getränke jedoch bereits im Folgejahr (Der Freisinnige 1903, Nr. 75 v. 1. Juli, 4).

Frühe Präsenz in der Schweiz (Neue Zürcher Zeitung 1902, Nr. 300 v. 29. Oktober, 7)
Im wichtigsten europäischen Markt, in Großbritannien, wurde keine Hopkos-Vertriebs-Gesellschaft gegründet, der Bierersatz lediglich als eine „new alcohol-free popular drink“ (The National Druggist 35, 1905, 275) wahrgenommen. Die Hamburger Hopkos-Company plante dagegen die Expansion nach Frankreich. Schon am 6. April 1903 erhielt sie ein fünfzehnjähriges Patent für Flaschenabfülleinrichtung mit vorgelagerter Mischung von Fruchtsirup und kohlensäurehaltigen Flüssigkeiten (Bulletin des Lois de le République Francaise 69, 1904, 428). Über die Nutzung dieses Patents Nr. 330.953 ist allerdings nichts bekannt (Brevet d’Invention 1903, Nr. 14, s.p.). In dem damals noch in Personalunion mit Norwegen vereinten Schweden, einem Kernland der Temperenzbewegung, bemühte sich die Hopkos-Gesellschaft um Franchisenehmer, lud Interessenten jedoch vergeblich zu persönlichen Verhandlungen nach Stockholm ein (Stockholms Dagblad 1903, Nr. 179 v. 7. Juli, 8). Erfolg hatte die Hamburger Firma jedoch im russischen und österreichisch-ungarischen Reich.

Erfolglose Werbereise zur Etablierung von Hopkos in Schweden – erfolgreiche Investorensuche in Budapest (Dagens Nyheter 1903, Nr. 11938 v. 7. Juli, 4; Pester Lloyd 1903, Nr. 124 v. 26. Mai, 4)
Nachdem die Investorensuche im cisleithanischen Österreich ohne Erfolg geblieben war, entstand im August 1903 in Budapest die Continental-Hopkos-Company, vermeintlich aufgrund der „in den letzten Wochen in massenhafter Weise aus allen europäischen und überseeischen Ländern an uns gelangten Aufträge zur Errichtung von Anlagen zur Hopkoserzeugung“ (Neue Freie Presse 1903, Nr. 13999 v. 18. August, 19). Sie sollte das Geschäft in Ungarn, Österreich und dem Orient organisieren.

Budapest als Standort der geplanten weiteren europäischen Expansion von Hopkos (Pester Lloyd 1903, Nr. 197 v. 16. August, 3)
Am Standort Budapest waren Lizenzen zu vergeben, wurden offiziell Extrakte und Maschinen gefertigt (Die Zeit 1903, Nr. 317 v. 18. August, 13). Die dortige Werbesprache lehnte sich an die deutschen Vorlagen an, propagierte das in Flaschen zu je vierzehn Heller erhältliche Erfrischungsgetränk aber auch als ein stärkendes „Heilgetränk“ für Sanatorien und Krankenhäuser (Pester Lloyd 1903, Nr. 235 v. 30. September, 13). Der Aufbau des Geschäfts erfolgte langsam, erst im Frühjahr 1905 bemühte man sich via Anzeige um kapitalkräftige Lizenznehmer in der Habsburgischen Monarchie (Kärtner Zeitung 1905, Nr. 40 v. 7. April, 7; Kurjer Lwowski 1905, Nr. 98 v. 8. April, 8). Der Konsum in Budapest soll damals 20.000 Flaschen täglich betrugen haben (Grazer Tagblatt 1905, Nr. 95 v. 4. Mai, 14). Nach wie vor aber hatte die mittlerweile in Fabrik alkoholfreier Fruchtextrakte Delpy & Co. m.b.H. umbenannte Hamburger Zentrale die Patentrechte inne (Österreichisches Patentblatt 13, 1905, 303). Die Budapester Dependance versuchte Hopkos in Galizien, insbesondere aber an Adriaküste, in Triest und Dalmatien, zu etablieren (Il Picolo 1905, Nr. 8508 v. 30. April, 3; ebd. 1905, Nr. 8582 v. 13. Juli, 3). Dies dürfte misslungen sein. Wahrscheinlich endete die Budapester Continental-Hopkos-Company 1907/08 (Adressbuch aller Länder der Erde 10, 1908, Bd. 18, 38).

Versuche der Etablierung von Hopkos im österreichischen Triest (Il Picolo 1905, Nr. 8485 v. 7. April, 5)
Schneller erfolgte die Etablierung in Russland, genauer im russisch beherrschten Finnland. Erste Werbeanzeigen findet man im Juni 1903; Mitte Juni 1903 wurde schließlich der Gesellschaftervertrag der „Finska Hopkos Aktiebolag“ in Helsinki genehmigt (Hufvudstadsbladet 1903, Nr. 161 v. 20. Juni, 3). In den Zeitungen klang es fast wie in Hamburg: „Das neue Erfrischungsgetränk ‚Hopkos‘, das in Finnland große Aufmerksamkeit erregt und sich in ganz Europa verbreitet, wird auch in Finnland immer beliebter“. Die Sachaussagen waren oft jedoch Wunschvorstellungen: „Der Preis wird so niedrig angesetzt, dass es hoffentlich auch in unserem Land Bier verdrängen kann, wie es in Deutschland, der Heimat des Bieres, bereits der Fall ist“ (Uusi Aura 1903, Nr. 128 v. 6. Juni, 1).

Werbung für Hopkos in der finnischen Hauptstadt Helsinki und in der Gewerbestadt Turko (Hufvudstadsbladet 1903, Nr. 280 v. 18. Oktober, 5 (l.); Uusi Aura 1903, Nr. 76 v. 7. Juli, 3; ebd., 1 (r., o.))
Hopkos galt anfangs als technische Errungenschaft, neben Anzeigen bekannten Tons traten vor Ort zudem Werbebeilagen und Flugblätter (Uusi Aura 1903, Nr. 205 v. 5. September, 2; Uusi Aura 1903, Nr. 160 v. 15. Juli, 1). Hopkos galt als „Amerikkaalista raittiusjuomaa“, als „Amerikanisches Mäßigkeitsgetränk“ (Wiipuri 1904, Nr. 36 v. 4. Mai, 1), während man Hamburg in der Werbung auch mal nach Sachsen verortete (Turun Lethi 1903, Nr. 66 v. 6. Juni, 2). Wie bei vielen deutschen Lizenznehmern war das amerikanisch-deutsche Getränk meist Teil eines breiteren Angebotes alkoholfreier Getränke (Uusi Aura 1903, Nr. 86 v. 30. Juli, 4; ebd. 1904, Nr. 44 v. 19. April, 1). Auch in Finnland wurde die Alkoholfreiheit des Bierersatzes besonders betont, musste auch hervorgehoben werden, da einzelne Analysen geringe Alkoholanteile ergaben (Wiipuri 1904, Nr. 94 v. 24. April, 2; Uusi Aura 1904, Nr. 157A v. 10. Juli, 2). Die lokale Produktion in Finnland dürfte Ende 1904 eingestellt worden sein.
Scheitern, Fortsetzungen und Ende in Hamburg
Die Lizenzeinkünfte aus mehreren deutschen Filialen und zwei europäischen Staaten waren allerdings nicht ausreichend für einen weiter profitablen Geschäftsbetrieb in Hamburg. Ein Jahr nach der Gründung begann der Ausverkauf. Die Einrichtung der Hopkos-Company, ihr Maschinenpark, auch weitere Produktionsmittel wurden erst Anfang Januar, dann nochmals Anfang öffentlich versteigert. Es galt offenbar, noch bestehende Werte zu monetarisieren.
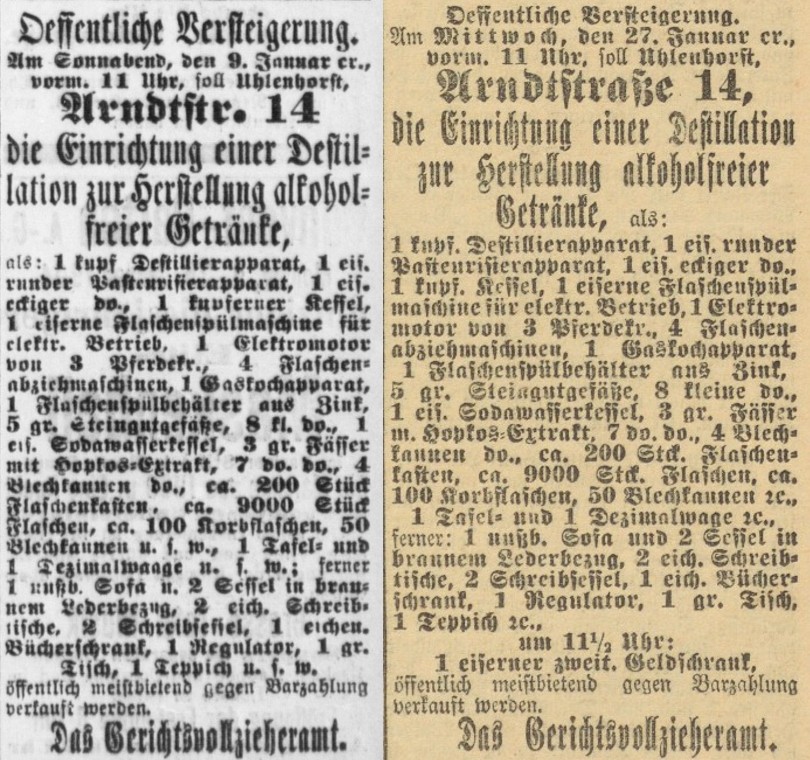
Versteigerung der Hopkos-Einrichtung Anfang 1904 (Hamburgischer Correspondent 1904, Nr. 9 v. 7. Januar, 7 (l.); Hamburger Fremden-Blatt 1904, Nr. 20 v. 21. Januar, 14)
Das Weltgeschäft war vor Ort überschaubar, versteigert wurde je ein Destillier- und Pasteurisierapparat, eine Flaschenspülmaschine, ein kleiner Elektromotor, mehrere Kessel, nur 9000 Flaschen und 200 Flaschenkästen, zudem 100 Korbflaschen und schließlich drei große Fässer mit Hopkos-Extrakt. Alles musste raus, schließlich auch der eiserne Geldschrank. Parallel verkaufte man weiter Restbestände des früheren Getränks der Zukunft.

Der Verkauf geht trotz Verkauf des Interieurs und Geräteparks weiter (Hamburger Fremden-Blatt 1904, Nr. 23 v. 28. Januar, 8; ebd. Nr. 25 v. 30. Januar, 8)
Mit Gesellschaftervertrag vom 1. Februar 1904 wurde die American German Hopkos Company in eine Nachfolgegesellschaft, die Internationale Hopkos Gesellschaft Delpy & Co. mbH überführt, die ein durchaus stattliches Stammkapital von 70.000 Mark aufwies (Deutscher Reichsanzeiger 1904, Nr. 35 v. 10. Februar, 11). Die früheren Macher waren großenteils nicht mehr mit an Bord, Hauptgesellschafter wurde der Kaufmann und Zivilingenieur Maria Hubert Felix Marbaise, der für die für 20.000 Mark bar von der Hopkos-Company erworbenen Firmenrechte – offenkundig Lizenzverträge – einen doppelt so hohen Kapitalanteil angerechnet bekam. Marbaise war nach der Heirat 1898 in die Hamburger Fa. Wilhelm Cordts eingetreten, die unter anderem Repräsentant des Aufzügeherstellers Deutschen Otis-Gesellschaft war, dessen Stammsitz in Yonkers, New York lag, direkt neben der Zuckerraffinerie eines Sohnes des deutsch-amerikanischen Zuckermagnaten Claus Spreckels. Marbaise übernahm diese Gesellschaft später, gründete zudem eine eigene Maschinenfabrik, scheiterte damit jedoch, musste 1910 Konkurs anmelden (Hamburger Fremyden-Blatt 1898, Nr. 270 v. 18. November, 22; Hamburgischer Correspondent 1900, Nr. 422 v. 9. September, 23; ebd. 1905, Nr. 110 v. 1. März, 17; ebd. 1910, Nr. 131 v. 13. März, 36; Hamburger Fremdenblatt 1911, Nr. 34 v. 9. Februar, 14). Neuer Geschäftsführer wurde der Harburger Kaufmann Konstantin Delpy, Kaufmann in Harburg (Neue Hamburgische Börsen-Halle 1904, Nr. 63 v. 7. Februar, 5). Diese Nachfolgegesellschaft wickelte die bisherige Hopkos-Company ab, führte das Lizenzgeschäft weiter, begann zudem mit der Produktion und dem Vertrieb eines neuen alkoholfreien Erfrischungsgetränkes.

Veränderter Firmennamen, unveränderte Anzeige, kontinuierlicher Absatz auch im Facheinzelhandel (Hamburger Fremden-Blatt 1904, Nr. 50 v. 28. Februar, 16 (l.); Bergedorfer Zeitung 1904, Nr. 73 v. 26. März, 5)
Die American German Hopkos Company mbH stellte am 13. Februar 194 ihre Zahlungen ein (Hamburgischer Correspondent 1904, Nr. 74 v. 13. Februar, 13). Die Umsetzung des Konkurses verzögerte sich mehrfach, der finale Prüfungstermin erfolgte schließlich Anfang August 1904. Die noch vorhandenen Mittel von 21.150 Mark wurden an die Gläubiger verteilt, insgesamt gab es Forderungen von 115.426,44 Mark (Hamburger Fremden-Blatt 1904, Nr. 163 v. 14. Juli, 22). Der Konkurs konnte daher Ende August aufgehoben werden (Deutscher Reichsanzeiger 1904, Nr. 205 v. 31. August, 11). Die American-German Hopkos Company mbH wurde schließlich am 25. September 1905 gelöscht (Ebd. 1905, Nr. 230 v. 29. September, 12).
Derweil waren ihre früheren Warenzeichen Anfang April 1904 auf die neue Internationale Hopkos-Gesellschaft übertragen worden, so dass es zumindest rechtlich keine Friktionen im parallel allerdings bröselnden Lizenzgeschäft gab (Ebd. 1904, Nr. 83 v. 8. April, 29). Doch die neue Gesellschaft präsentierte seit Ende April 1904 auch ein weiteres „nach patentiertem Verfahren aus Früchten zubereitet[es], hervorragendes Erfrischungsgetränk“ (Hamburger Fremden-Blatt 1904, Nr. 102 v. 1. Mai, 44). Das Warenzeichen für Calvina war bereits am 18. Juli 1903 beantragt worden, befand sich seit Ende September im Besitz der Hopkos-Company (Deutscher Reichsanzeiger 1903, Nr. 244 v. 16. Oktober, 15). Es handelte sich um gewerblich Nutzung eines der beiden 1900 an Carl Enoch erteilten Patente (Deutscher Reichsanzeiger 1900, Nr. 285 v. 2. Dezember, 13; ebd. 1905, Nr. 77 v. 30. März, 18; DE130103 – Google Patents).
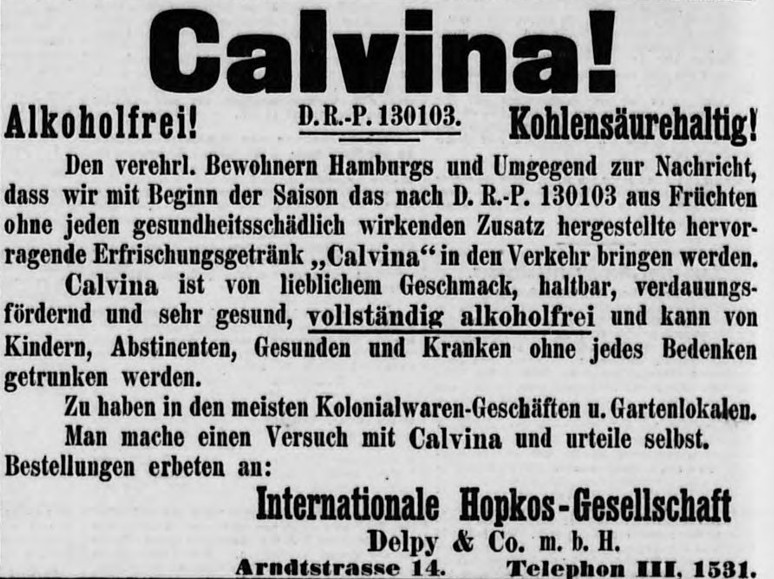
Erweiterung der Produktionspalette: Erfrischungsgetränk Calvina (Hamburger Nachrichten 1904, Nr. 284 v. 23. April, 4)
Das neue Getränk wurde aktiv, doch deutlich verhaltener angepriesen als Hopkos. Es hatte 0,37 Prozent Alkohol, war also durchaus „alkoholfrei“ (Neueste Erfindungen und Erfahrungen 33, 1906, 465). Doch neben Calvina wurde weiterhin auch Hopkos angeboten, beide mit Aplomb: „Von den alkoholfreien Getränken, welche jetzt eine große Rolle spielen, gehören die Fabrikate der ‚Internationalen Hopkos-Gesellschaft‘ zu den beliebtesten. Die unter den Namen ‚Hopkos‘ und ‚Calvina‘ hergestellten Getränke zeichnen sich durch leichte Bekömmlichkeit und angenehmen Geschmack aus, sodaß namentlich für den Sommer das Getränk sehr zu empfehlen ist“ (Hamburger Fremden-Blatt 1904, Nr. 102 v. 1. Mai, 30). Nur vereinzelt brachen die früheren Hopkos-Elogen sich Bahn, wurde vom Durst und der Durstnot geschrieben, bei der die „Hopkos-Gesellschaft“ helfen könne: „Wir trinken Hopkos abwechselnd hell und dunkel und zur besonderen Erbauung unserer Schluckwerkzeuge Calvina. Der ‚viele Durst‘ ist gestillt und keiner kann uns was anhaben!“ (Hopkos, Neue Hamburger Zeitung 1904, Nr. 207 v. 5. Mai, 3)
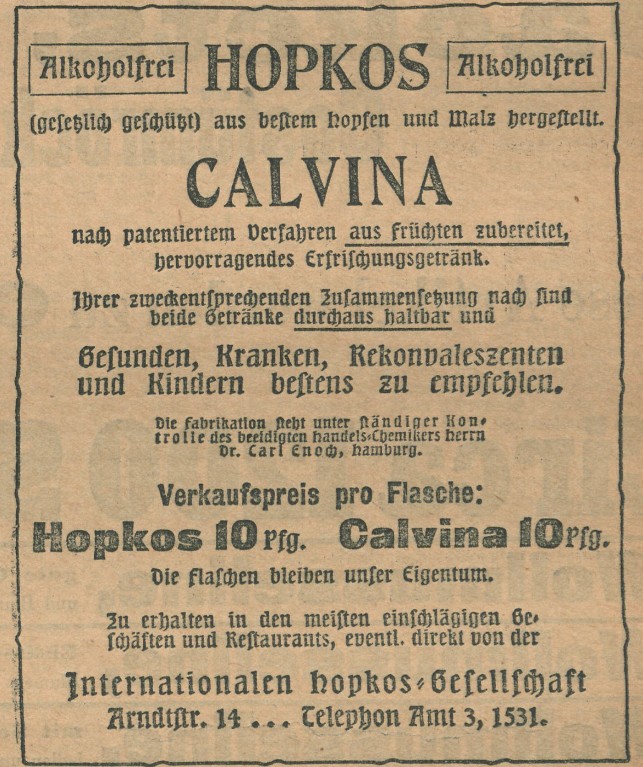
Daueranzeige für Hopkos und Calvina (Hamburger Fremden-Blatt 1904, Nr. 119 v. 22. Mai, 27)
Beide Produkte wurden im Mai/Juni 1904 mit nur einem Werbeklischee kontinuierlich angezeigt, Enochs geistige Vaterschaft darin nicht näher erwähnt, wohl aber seine kontinuierliche chemische Kontrolltätigkeit. Die Getränke verschwanden anschließend langsam, erschienen noch in Annoncen einzelner Händler (Bergedorfer Zeitung 1905, Nr. 222 v. 21. September, 4). Derweil hatte sich die Internationale Hopkos-Gesellschaft umbenannt, die Warenzeichen wurden Ende August 1905 an die Fabrik alkoholfreier Frucht-Extracte Delpy & Co. mbH übertragen (Deutscher Reichsanzeiger 1905, Nr. 54 v. 3. März, 23). Sie währte nicht lang, wurde am 19. Januar 1907 schließlich aufgelöst und von Konstantin Delpy liquidiert (Deutscher Reichsanzeiger 1907, Nr. 22 v. 25. Januar, 14).
Das Warenzeichen Hopkos überdauerte sie – zumindest formal. Es erlosch im Dezember 1910 nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist (Deutscher Reichsanzeiger 1910, Nr. 289 v. 9. Dezember, 36). Der Bedeutungsgewinn alkoholfreier karbonisierter Getränke, insbesondere von süßen Limonaden, wurde dadurch nicht gebremst, die schnelle Mark lockte weiterhin Investoren. Herbere Getränke, insbesondere die „alkoholfreien Biere“ hatten damals allerdings „noch keinen besonderen Anklang gefunden […] und es muß daher abgewartet werden, ob die Anstrengungen der Fabrikanten zur Verbesserung ihrer Erzeugnisse zum Ziele führen“ – so das Zwischenresümee der Temperenzler, die unter „alkoholfreien Bieren“ nach wie vor auch „braun gefärbte und aromatisierte Zuckerlösungen“ wie Methon und Hopkos verstanden (Mäßigkeits-Blätter 24, 1907, 202).
Uwe Spiekermann, 25. Oktober 2025